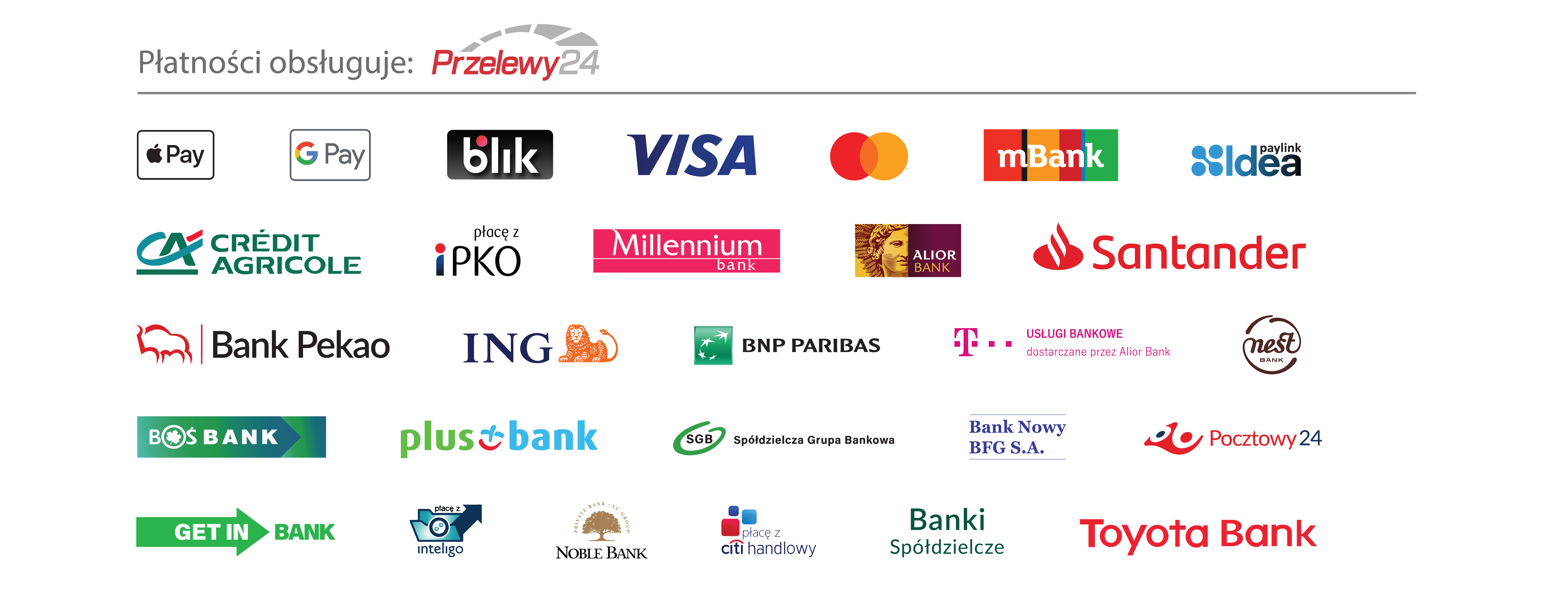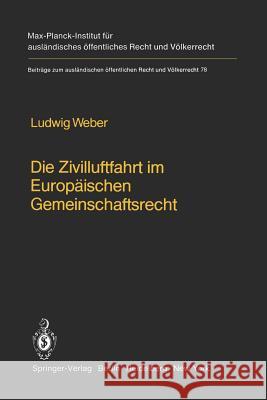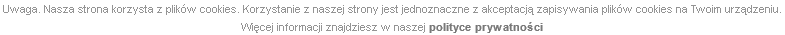Die Zivilluftfahrt Im Europäischen Gemeinschaftsrecht / Civil Aviation in European Community Law » książka


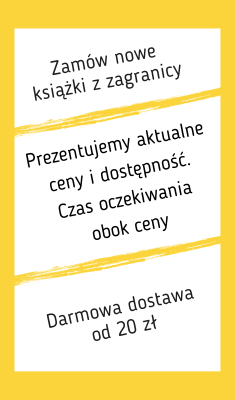
Die Zivilluftfahrt Im Europäischen Gemeinschaftsrecht / Civil Aviation in European Community Law
ISBN-13: 9783642680342 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 430 str.
Die Zivilluftfahrt Im Europäischen Gemeinschaftsrecht / Civil Aviation in European Community Law
ISBN-13: 9783642680342 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 430 str.
(netto: 179,39 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 179,98
ok. 22 dni roboczych
Bez gwarancji dostawy przed świętami
Darmowa dostawa!
Die internationale Zivilluftfahtt weist gegenwartig eine merkliche Tendenz zum "Re gionalismus" auf: zur engeren Zusammenarbeit zwischen benachbarten und politisch ahnlich strukturierten Staaten in regionalen Staatengruppen. Wahrend im weltweiten Rahmen die flugtechnischen und administrativen Normen und Standards, die im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) gelten, unverandert ihre wichtige Bedeutung behalten, findet sich im organisatorischen und wirtschaft lichen Bereich eine verstarkte Hinwendung zu den Moglichkeiten regionaler Zusam menarbeit und zur Orientierung an regionalen Gemeinsamkeiten. Die Europaische Zivilluftfahttkonferenz (ECAC), die Afrikanische Zivilluftfahrtkommission (AFCAC) und die Lateinamerikanische Zivilluftfahrtkommission (LACAC) haben ihren Tatig keitsbereich in den letzten funf Jahren merklich erweitert und vertieft, der Arabische Zivilluftfahrtrat (ACAC) ist in diesem Zeitraum neu entstanden. Im afrikanischen Rahmen soll die Frage der Flugtarife in einem neuen Gremium (AFRATC) behandelt werden. Auf wirtschaftlichem Gebiet fuhren Entwicklungen wie das enorme Anstei gen der Treibstoffpreise, Veranderungen in den internationalen Wettbewerbsbedin gungen und die amerikanische Deregulierungspolitik zu Ergebnissen, die eine engere Zusammenarbeit im regionalen Rahmen generell begunstigen. Das verstarkte Interesse und die seit 1977 einsetzenden aktiven Bemuhungen der EG um die Erarbeitung einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet der Zivilluftfahrt fugen sich daher in eine allgemeine Entwicklung ein. Sie erscheinen von daher als ein durchaus realistischer Ansatz fur eine Weiterentwicklung der europaischen Luftfahrt im internationalen Rahmen. Der EWG-Vertrag von 1957 bietet eine Vielfalt von Moglichkeiten fur verstarkte Konsultation, Harmonisierung, Kooperation und Inte gration, die auch fur die zivile Luftfahrt genutzt werden konnen."
Einleitung: Das Problem der Zivilluftfahrt im Europäischen Gemeinschaftsrecht.- I. Einführung in die Problemstellung.- 1. Historischer Überblick.- 2. Die rechtlichen Probleme.- 3. Die politischen Probleme.- 4. Praktische Folgen.- II. Aufgabe der Untersuchung.- 1. Gegenstand.- 2. Methodische Folgerungen.- 3. Stand der Diskussion.- 4. Ziele der Untersuchung.- III. Begriffliche Abgrenzung.- A: Grundlagen und Grundsatzfragen.- 1. Kapitel: Bisherige Bestrebungen zur Integration der europäischen Zivilluftfahrt.- § 1. Voraussetzungen und Gründe für europäische Integrationsbestrebungen.- I. Voraussetzungen.- II. Gründe für bisherige Bestrebungen.- § 2. Frühe Bestrebungen zur „Internationalisierung“ der europäischen Zivilluftfahrt (1932–1944).- I. Die französischen Vorschläge auf der Genfer Abrüstungskonferenz 1932.- II. Der Lawson-Plan.- III. Die britischen Vorschläge auf der Konferenz von Chicago 1944.- IV. Würdigung.- § 3. Pläne im Rahmen des Europarats (1950–1953).- I. Natur und Inhalt der Pläne.- Sforza-Plan (27) — Bonnefous-Plan (27) — Van de Kieft-Plan (28).- II. Behandlung im Ministerrat.- § 4. Die Konferenz zur Koordinierung des Luftverkehrs in Europa (CATE), Straßburg 1954.- I. Verlauf und Ergebnisse.- II. Würdigung.- III. Die Vorschläge von Wheatcroft.- § 5. Die Europäische Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC).- I. Aufgaben und Status.- II. Organisationsstruktur.- III. Tätigkeit.- § 6. Die Flugsicherungsorganisation „Eurocontrol“.- I. Gründung und Aufgaben.- II. Das „harmonisierte Regionalsystem“.- § 7. Die SAS und das Air Union-Projekt.- I. Die SAS.- II. Das Air Union-Projekt.- 2. Kapitel: Die Struktur der europäischen Zivilluftfahrt.- § 8. Die rechtliche Struktur.- I. Der Grundsatz der Lufthoheit und die Verkehrsrechte.- II. Internationaler Gelegenheitsverkehr.- III. Internationaler Linienverkehr.- 1. Das System der bilateralen Verkehrsabkommen.- 2. Die Kapazitätsregelungen.- 3. Die Tarifregelungen.- 4. Die Designierung.- 5. Die Bildung eines „Pools“ (Abkommen über kommerzielle oder betriebliche Zusammenarbeit).- 6. Der Inhalt eines Pool-Abkommens.- IV. Erleichterungen (facilitation).- V. Staatszugehörigkeit und Flaggenwahrheit.- § 9. Die wirtschaftliche Struktur.- I. Bedeutung des europäischen Luftverkehrs.- II. Besonderheiten des europäischen Luftverkehrs.- 1. Geographische und Infrastrukturbesonderheiten.- 2. Vielfalt der Luftfahrtunternehmen.- 3. Das Routensystem.- 4. Das Tarifniveau.- 5. Die Verkehrsströme.- 6. Die Beschäftigten.- III. Die Wirtschaftlichkeit des Luftfahrtunternehmens.- 1. Eigenwirtschaftlichkeit und Gesamtwirtschaftlichkeit.- 2. Kapitalbeschaffung.- 3. Subventionen.- IV. Die Wettbewerbssituation.- 1. Die Instrumente des Wettbewerbs.- 2. Die Auswirkungen der IATA auf den Wettbewerb.- 3. IATA und Gelegenheitsverkehr.- 4. Der Wettbewerb mit den übrigen Verkehrsträgern.- V. Preis- und Tarifpolitik.- 1. Gelegenheitsverkehr.- 2. Inlandslinienverkehr.- 3. Internationaler Linienverkehr.- § 10. Die organisatorische Struktur.- I. Die internationale Ebene.- 1. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO).- 2. Die Europäische Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) und Eurocontrol.- 3. Der Europarat.- 4. A.A.A. und N.S.S.F.- 5. Sonstige Organisationen.- II. Die einzelstaatliche Ebene.- 1. Die staatlichen Luftfahrtzuständigkeiten.- 2. Inhalt der staatlichen Zuständigkeiten.- 3. Die staatlichen Luftfahrtverwaltungen.- III. Die Ebene der Luftfahrtunternehmen.- 1. Arten der Luftfahrtunternehmen.- 2. Eigentumsverhältnisse.- 3. Beschaffungspolitik.- 4. Zusammenarbeit auf weltweiter Ebene.- a) Die International Air Transport Association (IATA).- b) Die Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA).- c) Die International Air Carrier Association (IACA).- 5. Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.- a) Die Association of European Airlines (AEA).- b) ATLAS und KSSU.- c) Pool-Abkommen.- d) Vertretungsabkommen und Interline Agreements.- e) Handling Agreements.- f) Wartungsabkommen.- g) Austausch von Luftfahrzeugen.- h) „Hire“ und „charter“ von Luftfahrzeugen.- i) Luftfahrzeug-leasing.- 3. Kapitel: Die Frage der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsverträge auf die Zivilluftfahrt.- § 11. Wirtschaftsliberalisierung und Luftfahrt.- I. Die EG als Faktor der allgemeinen Wirtschaftsliberalisierung.- II. Die Behandlung der Luftfahrt bei der Gründung der EWG.- III. Allgemeine Wirtschaftsintegration und Luftfahrt.- IV. Die politische und rechtliche Haltung der Mitgliedstaaten.- 1. Das Überwiegen der minimalistischen Auffassung.- 2. Ursachen.- 3. Die Luftfahrt unter nationaler Kontrolle.- § 12. EGKS- und Euratom-Vertrag; Benelux-Abkommen.- I. Der EGKS-Vertrag.- II. Der Euratom-Vertrag.- III. Das Benelux-Abkommen.- Die Luftfahrtklausel des Art. 89.- Die Zusammenarbeit der Benelux-Luftfahrtunternehmen.- § 13. Der EWG-Vertrag.- I. Überblick über die einschlägigen Bestimmungen.- II. Der Streit um die Auslegung des Art. 84 EWGV.- III. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 4. April 1974 in der Rechtssache „Kommission gegen Französische Republik“ (Seeleute).- 1. Die Vorgeschichte.- 2. Die Standpunkte der Parteien.- 3. Die Entscheidung des Gerichtshofs.- IV. Die Frage der Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts im Lichte der Seeleute-Entscheidung.- 1. Bedeutung der Entscheidung für die Luftfahrt.- 2. Fragestellungen als Folge der Entscheidung.- a) Der Begriff der allgemeinen Vorschriften.- b) Die Problematik der Anwendung der allgemeinen Vorschriften.- c) Der Bezug zur gemeinsamen Verkehrspolitik.- d) Sonstige Fragestellungen.- V. Die bisherigen praktischen Auswirkungen des Seeleute-Urteils im Bereich der Zivilluftfahrt.- 1. Überblick.- 2. Die minimalistische Auslegung des Urteils.- 3. Die gegenwärtige Rechtsunsicherheit.- § 14. Grundsätzliche Überlegungen zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf die Zivilluftfahrt.- I. Die Universalität des EWG-Vertrages und sein „Regelungsdefizit“.- II. Die „instante“ Anwendung des Vertrages und ihre Probleme.- I. Die Probleme des EWG-Niederlassungs- und Wettbewerbsrechts: „systemwidriges“ Luftfahrtrecht?.- II. Der „Gemeinschaftsanspruch“ der EG gegenüber Drittstaaten in den internationalen Luftfahrtbeziehungen.- 1. Die Schaffung partikulären Luftrechts.- 2. Die „Vergemeinschaftung“und ihre Anerkennung.- 3. Vergleichbare Probleme im Rahmen der Handelspolitik.- V. Das Gemeinschaftsrecht und die Stellung des Staates im Luftrecht.- 1. Der Grundsatz der Lufthoheit und die nationale Luftfahrtgesellschaft.- 2. Die „nationalen“ Aspekte der staatlichen Luftfahrtpolitik.- 3. Andere Aspekte der staatlichen Luftfahrtpolitik.- 4. Staatliche Luftfahrtzuständigkeiten und Integration.- VI. Gemeinschaftsrecht als „Luftfahrtrecht“.- VII. Vergleichbare Vergemeinschaftungsprozesse in der Luftfahrt.- 1. Überblick.- 2. Das Abkommen über Luftverkehr in Afrika (Abkommen von Yaounde, 1961).- 3. Die Ostafrikanische Gemeinschaft (1967) und die East African Airways Corporation (bis 1977).- B: Die Anwendung des EWG-Vertrags auf die Zivilluftfahrt.- 4. Kapitel: Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. April 1974 (Seeleute) als Grundlage für die Anwendung des Vertrages.- § 15. Der Begriff der „allgemeinen Vorschriften“ des Vertrags.- I. Die alternativen Auslegungsmöglichkeiten.- 1. Die minimalistische Lösung.- 2. Die maximalistische Lösung.- II. Die gebotene Auslegung des Begriffs.- 1. Die minimalistische Lösung und die Einheit des Vertrags.- 2. Die Schlußanträge und die Urteilsformulierungen.- 3. Der Fall Defrenne.- § 16. Das Verhältnis der allgemeinen Vertragsvorschriften zu Art. 84 EWGV.- I. Das Problem der Nichtanwendbarkeit des Verkehrstitels.- 1. Die Anpassung der allgemeinen Vorschriften an die strukturellen Besonderheiten der Luftfahrt.- 2. Die Bedeutung des Vertragsziels des Art. 3 e EWGV.- II. Art. 84 Abs. 2 als Vorbehalt bezüglich der allgemeinen Vorschriften?.- § 17. Das „Regelungsdefizit“ des Vertrages auf dem Gebiet des Luftverkehrs.- I. Das „Regelungsdefizit“ in bezug auf eine künftige Luftverkehrspolitik.- 1. Offenhaltung der künftigen Ausgestaltung?.- 2. Der Inhalt des Art. 75 als Auslegungshilfe.- II. Die Möglichkeit der Derogierung des Art. 84.- § 18. Die Anwendung des Vertrages auf Luftfahrtunternehmen aus Nicht-EG-Staaten.- I. Der personale Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts.- 1. Die Nicht-EG-Unternehmen und das Wettbewerbsrecht.- 2. Der Continental Can-Fall.- 3. Der personale Anwendungsbereich und die Nicht-EG-Luftfahrtunternehmen.- II. Der territoriale Anwendungsbereich des EWG-Vertrages.- 5. Kapitel: Die Anwendung der allgemeinen Vertragsvorschriften — Materiell-rechtliche Fragen.- § 19. Der Erste Teil des Vertrages: Die Grundsätze.- I. Die Vertragsziele der Art. 2 und 3 EWGV.- 1. Bedeutung für den Bereich der Luftfahrt.- 2. Der Bezug zwischen Art. 3 e und Art. 74 EWGV.- II. Der Grundsatz der Gemeinschaftstreue des Art. 5 EWGV.- 1. Der Grundsatz der Gemeinschaftstreue und das Seeleute-Urteil.- 2. Das Unterlassungsgebot des Art. 5 Abs. 2 EWGV.- III. Zusammenarbeit und Rücksichtnahme gemäß Art. 6 EWGV.- 1. Wirtschaftspolitik im Sinne des Art. 6 und Luftfahrt.- 2. Die Koordinierungspflicht.- 3. Die Pflicht zur Rücksichtnahme.- IV. Das Diskriminierungsverbot des Art. 7 EWGV.- 1. Inhalt und Systematik des Art. 7.- 2. Art. 7 auf den Verkehrsbereich anwendbar?.- 3. Art. 7 im Luftverkehrsbereich.- § 20. Der Zweite Teil des Vertrages: Die Grundlagen der Gemeinschaft.- I. Der freie Warenverkehr.- Gemeinschaftliches Versandverfahren.- Zollrechtliche Behandlung von Bordbedarf.- Einfuhr von Bau-, Ersatz- und Ausrüstungsteilen für Luftfahrzeuge.- II. Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Art. 48–51 EWGV.- 1. Der Inhalt des Art. 48.- 2. Die Ausnahmeklausel des Art. 48 Abs. 4 und die Luftfahrt.- 3. Nationale Luftfahrtlizenzen als Einstellungsvoraussetzung.- a) Die Wirkungen der unmittelbaren Anwendbarkeit des Art. 48.- b) Die Anerkennung der Gleichwertigkeit in der Rechtsprechung des Gerichtshofs.- c) Die Gleichwertigkeit der Luftfahrtlizenzen.- 4. Soziale Sicherung und Vereinfachungsfragen.- III. Die Niederlassungsfreiheit, Art. 52–58 EWGV.- 1. Inhalt des Art. 52.- 2. Das „Allgemeine Programm“ von 1961.- 3. Die Rechtslage auf der Grundlage der Fälle Seeleute und Reyners.- 4. Der Streit um die Modalitäten der Anwendung des Art. 52.- a) Der Standpunkt der Kommission.- b) Der Standpunkt der Mitgliedstaaten.- 5. Die Auslegung des Art. 52 auf der Grundlage der Seeleute-Entscheidung.- a) Das Problem der Eintragung in die Luftfahrzeugrolle.- aa) Die Problematik.- bb) Das Konzept der Staatszugehörigkeit von Luftfahrzeugen.- cc) Das Gegenargument der „Eigentümerklausel“.- dd) Sonstige Gegenargumente.- ee) Ergebnis.- b) Das Problem der Linienkonzessionen.- aa) Die Problematik.- bb) Inländerbehandlung und Linienkonzession.- cc) Die Linienkonzession für internationale Strecken.- dd) Die Anpassung entsprechend Art. 234 Abs. 2.- c) Das Problem der Erlaubnis für Charterflugbetrieb.- aa) Die Problematik.- bb) Die Durchführung internationaler Beförderungen.- d) Ergebnis und abschließende Betrachtung.- IV. Der Dienstleistungsverkehr, Art. 59–66 EWGV.- V. Der Kapitalverkehr, Art. 67–73 EWGV.- VI. Die Verkehrsvorschriften der Art. 74–84 EWGV: Ihre Bedeutung für den Luftverkehrssektor.- § 21. Der Dritte Teil des Vertrages: Die Politik der Gemeinschaft.- I. Überblick.- II. Die Wettbewerbsregeln.- 1. Inhalt und grundsätzliche Anwendbarkeit der Art. 85, 86 EWGV.- 2. Die Verordnungen (EWG) Nr. 17 und Nr. 141.- 3. Die vorläufige Anwendung der Art. 88, 89.- a) Das Regelungsdefizit und die Anwendung der Art. 88, 89.- b) Die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit des Art. 85 Abs. 1 im Rahmen der Art. 88, 89 EWGV.- c) Die Anwendung des Art. 85 Abs. 2 nach den Grundsätzen des Bosch-Urteils.- 4. Die Anwendung der Art. 85 Abs. 1, 86 EWGV.- a) Die Tarifabsprachen im Rahmen der IATA.- b) Das IATA-„Agentur-Programm“.- c) Die marktbeherrschende Stellung der IATA.- d) Die Pool-Abkommen.- 5. Die Freistellung gemäß Art. 85 Abs. 3 EWGV.- a) Der Inhalt des Art. 85 Abs. 3.- b) Der Diskussionsstand in bezug auf IATA.- c) Verfahrensfragen im Rahmen des Art. 85 Abs. 3 EWGV.- d) Aussichten einer Freistellung für Partner von Pool-Abkommen.- 6. Die Anwendung der Art. 85 ff. auf Unternehmen des gewerblichen Gelegenheitsverkehrs.- III. Die „öffentlichen Unternehmen“ der Luftfahrt. Die Anwendung des Art. 90 EWGV.- 1. Inhalt und Problematik des Art. 90 EWGV.- 2. Die Anwendbarkeit des Art. 90 Abs. 1 EWGV.- a) Linienflugunternehmen.- b) Charterflugunternehmen.- 3. Die Ausnahmevorschrift des Art. 90 Abs. 2.- a) Der Stand der Diskussion zur Anwendung des Art. 90 Abs. 2 auf Luftfahrtunternehmen.- b) Art. 90 Abs. 2 unmittelbar anwendbar?.- c) Das Problem der Vereinbarkeit der Vertragsanwendung und der besonderen Aufgabenerfüllung der Luftfahrtunternehmen im Rahmen einer möglichen Freistellung gemäß Art. 90 Abs. 3.- aa) Natur und Ursprung der besonderen Aufgabe.- bb) Die Problematik des „freien Wettbewerbs“in der Luftfahrt.- cc) Die internationale Verflechtung der Luftfahrt.- d) Die Zuständigkeit zur Anwendung des Art. 90 Abs. 2 bis zum Erlaß einer Regelung gemäß Art. 90 Abs. 3.- e) Verfahrensfragen.- f) Die rechtlichen Wirkungen der Anwendung des Art. 90 Abs. 2 EWGV.- 4. Zusammenfassung: Die Erforderlichkeit einer sekundärrechtlichen Wettbewerbsregelung für die Luftfahrt.- IV. Die staatlichen Beihilfen, Art. 92–94 EWGV.- 1. Zweck und Inhalt der Beihilfevorschriften.- 2. Staatliche Subventionen in der Luftfahrt.- 3. Die Vereinbarkeit der Subventionen mit Art. 92.- 4. Verfahrensfragen.- V. Steuerliche Vorschriften, Art. 95–99 EWGV.- 1. Das Mehrwertsteuersystem und der Luftverkehr.- 2. Die inhaltliche Vereinbarkeit mit der ICAO-Entschließung vom 14. November 1966.- 3. Sonstige ICAO-Entschließungen zu Steuerfragen.- VI. Die Angleichung der Rechtsvorschriften, Art. 100 EWGV.- VII. Die gemeinsame Handelspolitik, Art. 110–116 EWGV.- 1. Sinn und Inhalt der Art. 110 ff..- 2. Der Streit um den Anwendungsbereich der Art. 110 ff..- a) Der Standpunkt der Kommission.- b) Der Standpunkt des Rates.- c) Die Art. 110 ff. und das System des Vertrages.- 3. Inhalt und Anwendbarkeit des Art. 116 EWGV.- VIII. Die Sozialpolitik, Art. 117 ff. EWGV.- 1. Die Anwendung des Art. 119 im Fall Defrenne.- 2. Die Schaffung sozialer Schutzbestimmungen für die Beschäftigten der Luftfahrt.- § 22. Sonstige Teile des Vertrages.- I. Die Assoziierungsvorschriften, Art. 131–136.- II. Allgemeine und Schlußvorschriften, Art. 210–248.- 1. Informationspflichten.- 2. Die finanzielle Beteiligung an Luftfahrtgesellschaften durch EG-Angehörige.- 3. Beziehungen der EG zu internationalen Luftfahrtorganisationen.- a) Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO).- b) Die Europäische Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC).- 4. Völkerrechtliche Luftfahrtabkommen.- a) Das künftige Verfahren beim Abschluß durch die EG.- b) Abkommen der Mitgliedstaaten.- 5. Die Kompetenz für im Vertrag nicht vorgesehene Maßnahmen, Art. 235 EWGV.- 6. Kapitel: Die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Luftfahrt.- § 23. Grundsätzliche Überlegungen zur ZuständigkeitsVerteilung in der Gemeinschaft.- I. Die materielle Abgrenzung.- II. Die funktional-instrumentelle Abgrenzung.- III. Die funktional-zeitliche Abgrenzung.- § 24. Die Zuständigkeitsverteilung auf dem Verkehrssektor.- I. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs im AETR-Fall.- II. Der Ausbau dieser Rechtsprechung.- III. Der Grundsatz des „Schutzes der einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts“.- § 25. Die Zuständigkeitsverteilung auf dem Luftfahrtsektor.- I. Luftfahrt als Teil des Verkehrssektors.- II. Die Zuständigkeiten der Gemeinschaft.- 1. Die gemeinsame Politik.- 2. Zuständigkeiten für den rein innerstaatlichen Luftverkehr?.- 3. Die Außenkompetenzen.- 4. Sonstige „Einzelzuständigkeiten“der Gemeinschaft.- 5. Ausschließliche Zuständigkeiten der Gemeinschaft?.- a) Unmittelbar auf Grund des Vertrages.- b) Durch „Gebrauchmachen“von konkurrierenden Zuständigkeiten.- III. Die Befugnisse der einzelnen Gemeinschaftsorgane.- 1. Der Rat.- a) Befugnisse gemäß Art. 84 Abs. 2.- b) Sonstige Einzelbefugnisse.- 2. Die Kommission.- a) Initiativrechte.- b) Rechtsetzungsbefugnisse.- c) Uberwachungs- und Kontrollbefugnisse.- d) Befugnisse im Rahmen der Außenbeziehungen.- 3. Das Parlament.- 4. Der Gerichtshof.- 5. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß.- 6. Der Beratende Verkehrsausschuß.- IV. Die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten.- 1. Die rechtlichen Wirkungen des Vertrages auf die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten.- 2. Gemeinschaftsrechtliche Bindungen bei der Ausübung ihrer Zuständigkeiten.- 7. Kapitel: Der EWG-Vertrag und die Regelungen des internationalen Luftrechts.- § 26. Der EWG-Vertrag und das Abkommen von Chicago.- I. Die Vereinbarkeit mit Art. 1 des Abkommens.- II. Die Vereinbarkeit mit den Diskriminierungsverboten des Abkommens.- 1. Die Vereinbarkeit mit Art. 7 ChicAbk..- 2. Die Vereinbarkeit mit den übrigen speziellen Diskriminierungsverboten.- III. Die Vereinbarkeit mit den Art. 17 ff. des Abkommens.- IV. Bindung der Gemeinschaft an das Abkommen?.- 1. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs im GATT-Fall.- 2. Anwendbarkeit der Grundsätze des GATT-Urteils?.- 3. Ergebnis.- § 27. Der EWG-Vertrag und die bilateralen Luftverkehrsabkommen der Mitgliedstaaten.- I. Natur und Regelungsinhalt eines bilateralen Luftverkehrsabkommens.- 1. Die Rechtsnatur.- 2. Der Regelungsinhalt.- 3. Der EWG-Vertrag und die Luftverkehrsabkommen.- II. Die Vereinbarkeit mit den typischen Klauseln eines bilateralen Luftverkehrsabkommens.- 1. Die Klausel über den Austausch der Verkehrsrechte.- 2. Die Bezeichnungsklausel („designa tion“).- 3. Die Eigentümerklausel („ownership and effective control“).- 4. Die gegenseitige Anerkennung von Lufttüchtigkeits- und Befähigungszeugnissen.- 5. Die Zollklausel.- 6. Die Kapazitätsklausel.- 7. Die Tarifklausel; das mehrseitige Pariser Abkommen von 1967.- 8. Die Pool-Klausel.- III. Kollisionsregelungen bei Unvereinbarkeit zwischen Luftverkehrsabkommen der EG-Mitgliedstaaten untereinander und dem Gemeinschaftsrecht.- 1. Die „Ablösungs“-Regel des Gerichtshofs.- 2. Die Ausstrahlungswirkungen bilateraler Luftverkehrsabkommen auf dritte Staaten.- 3. Die „Bestandsthese“im Schrifttum.- 4. Die entsprechende Anwendung des Art. 234 EWGV.- IV. Kollisionsregelungen bei Unvereinbarkeit zwischen Luftverkehrsabkommen der EG-Mitgliedstaaten mit Drittstaaten und dem Gemeinschaftsrecht.- 1. Die Regelung des Art. 234 für „Altverträge“.- 2. Die Regelung für „Neuverträge“.- a) Grundsätzliche Überlegungen.- b) Die Folgen der „verspäteten“ Vertragsanwendung.- c) Ergebnis.- V. Freie Wahl der Mittel für die Mitgliedstaaten bei der Anpassung ihrer bilateralen Luftverkehrsbeziehungen?.- 1. Die grundsätzlich freie Wahl der Mittel.- 2. Würdigung der verschiedenen Möglichkeiten.- VI. Inhaltliche Bindungen der Mitgliedstaaten bei der künftigen Gestaltung ihrer Luftverkehrsbeziehungen?.- 8. Kapitel: Der EWG-Vertrag und die Regelungen des nationalen Luftrechts.- § 28. EWG-Vertrag und nationales Luftrecht der Mitgliedstaaten.- I. Allgemeine Überlegungen zur Vorrangfrage.- II. Die Vereinbarkeit der typischen luftrechtlichen Regelungen mit dem Vertrag.- 1. Der Staatsangehörigkeitsvorbehalt.- 2. Der Gegenseitigkeitsvorbehalt.- 3. Der Kabotagevorbehalt.- a) Inhalt und Anwendungsbereich.- b) Die Vereinbarkeit mit Art. 52 EWGV.- c) Die Zulassung von EG-Ausländern zum Kabotageverkehr.- 4. Die Luftfahrt-Freistellungsklauseln in den nationalen Kartell-vorschriften.- a) Inhalt und Anwendungsbereich.- b) EWG-Wettbewerbsregeln und nationales Kartellrecht.- Zweischrankentheorie.- Rechtsprechung des Gerichtshofs im Fall Wilhelm gegen Bundeskartellamt.- c) Würdigung.- III. Der „Grundsatz“des Schutzes der nationalen Luftfahrtgesellschaft.- 1. Inhalt und Gegenstand.- 2. Die Frage der Vereinbarkeit mit dem EWG-Vertrag.- a) Grundsätzliche Überlegungen.- b) Das Konzessionierungssystem und Art. 85, 86 EWGV.- c) Ergebnis.- 9. Kapitel: Gemeinschaftsrecht und Luftverkehrspolitik.- § 29. Allgemeine Überlegungen.- I. Die mitgliedstaatlichen Luftfahrtinteressen und die gemeinsame Politik.- II. Die Anpassung der allgemeinen Vertragsvorschriften.- III. Grundprobleme bei der Entwicklung einer gemeinsamen Politik.- 1. Die Vertragsentfaltung und die Strukturbesonderheiten der Luftfahrt.- 2. Die besondere Bedeutung des politischen Willens dritter Staaten.- IV. Inhaltliche Faktoren für die Entwicklung einer gemeinsamen Politik.- 1. Luftverkehrspolitik und politische Einigung.- 2. Luftverkehrspolitik und Luftfahrzeugbau-Industriepolitik.- 3. Luftverkehrspolitik und Luftverkehrssicherung.- 4. Luftverkehrspolitik und sonstige Zusammenhänge.- § 30. Die Tätigkeit der Kommission zur Einleitung einer gemeinsamen Luftverkehrspolitik.- I. Die Bemühungen um die Einbeziehung der Luftfahrt in die Gemeinschaftstätigkeit, 1959–1965.- II. Die Entwicklung konkreter Vorschläge, 1970–1974.- III. Die Tätigkeit auf der Grundlage des Seeleute-Urteils, 1974 — heute.- 1. Der Kommissionsvorschlag vom 3. Oktober 1975.- 2. Die Vorbereitung einer Luftfahrt-Wettbewerbsverordnung.- 3. Das Memorandum vom 4. Juli 1979.- § 31. Die Tätigkeit des Europäischen Parlaments zur Einleitung einer gemeinsamen Luftverkehrspolitik.- I. Die Entschließungen von 1961 und 1962.- II. Die Entschließungen von 1965, 1973 und 1974.- III. Die Entschließungen seit 1975.- § 32. Die Tätigkeit des Rates auf dem Gebiet der Luftverkehrspolitik.- I. Die Bemühungen um die Freistellung der Luftfahrt von der Gemeinschaftstätigkeit.- 1. Überblick.- 2. Das Niederlassungsrecht.- 3. Das Wettbewerbsrecht.- 4. Das Air Union-Projekt.- II. Die Tätigkeit auf der Grundlage des Seeleute-Urteils.- 1. Luftfahrzeugbau-Industriepolitik.- 2. Das Arbeitsprogramm vom 28./29. Juni 1977.- 3. Die Tätigkeit der „Luftfahrt-Arbeitsgruppe“ des Rates seit 1977.- 4. Die Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 1979 zur Einführung eines Konsultationsverfahrens in Fragen des Luftverkehrs.- 5. Die Richtlinie des Rates vom 20. Dezember 1979 zur Verringerung des Fluglärms.- § 33. Konturen einer gemeinsamen Politik.- I. Überblick.- II. Anpassungsmaßnahmen.- 1. Das Niederlassungsrecht.- 2. Das Wettbewerbsrecht.- 3. Die Beihilferegeln.- III. Harmonisierungsmaßnahmen.- 1. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe des Rates.- 2. Ähnliche Maßnahmen wie auf den Binnenverkehrssektoren?.- IV. Integrationsmaßnahmen im engeren Sinn.- 1. Voraussetzungen.- 2. Der rechtliche Rahmen für Maßnahmen des Rates.- 3. Die inhaltliche Leitbildfunktion der Art. 74 ff. EWGV.- a) Regelungen für den internationalen Verkehr.- b) Kapazitätsregelungen.- c) Routenfestlegung.- d) Der Zugang zu den Inlandsmärkten.- e) Beihilfen und Wettbewerb.- f) Luftverkehrsabkommen mit Drittstaaten.- Zusammenfassung und Schlußbetrachtung.- Summary: Civil Aviation in European Community Law.
1997-2025 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa