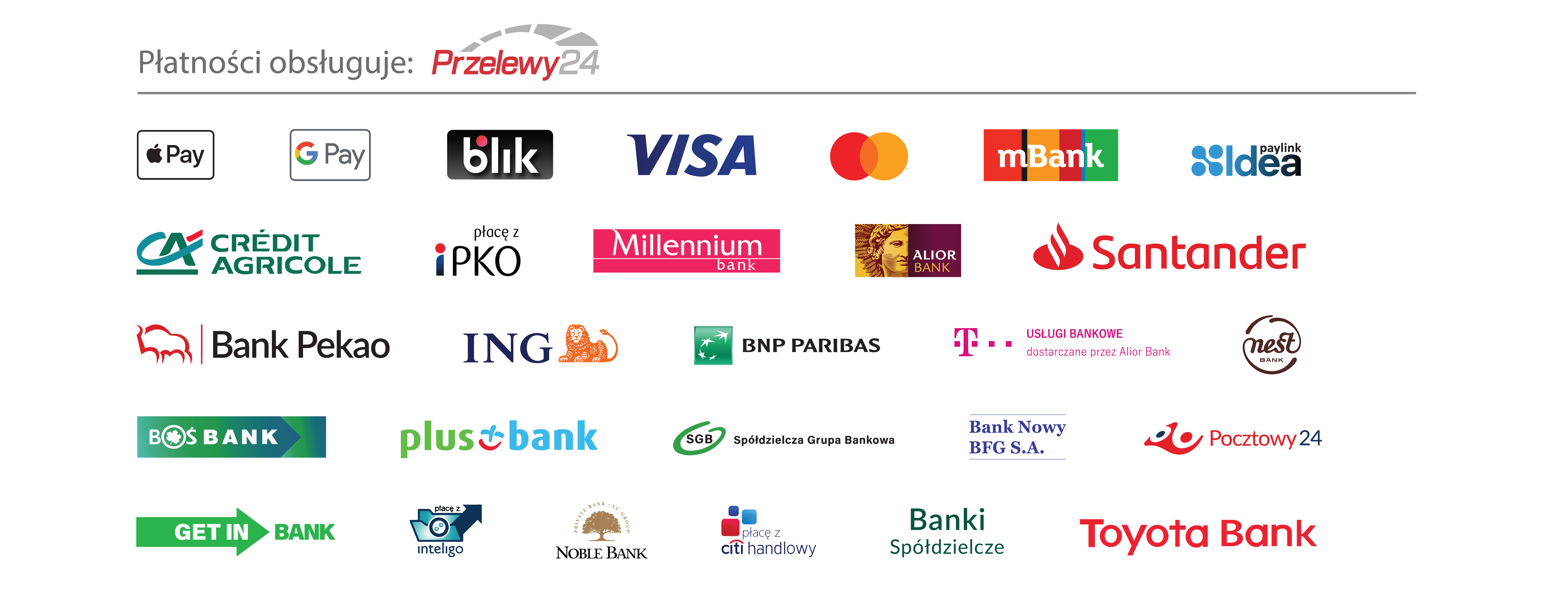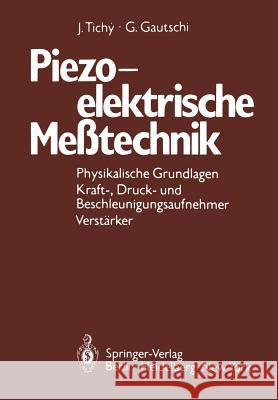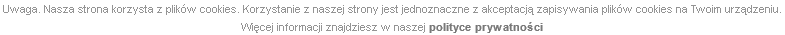Piezoelektrische Meßtechnik: Physikalische Grundlagen, Kraft-, Druck- Und Beschleunigungsaufnehmer, Verstärker » książka


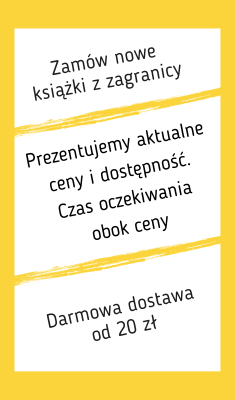
Piezoelektrische Meßtechnik: Physikalische Grundlagen, Kraft-, Druck- Und Beschleunigungsaufnehmer, Verstärker
ISBN-13: 9783642522024 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 262 str.
Piezoelektrische Meßtechnik: Physikalische Grundlagen, Kraft-, Druck- Und Beschleunigungsaufnehmer, Verstärker
ISBN-13: 9783642522024 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 262 str.
(netto: 215,48 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 216,18
ok. 22 dni roboczych.
Darmowa dostawa!
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Piezoelektrizität.- 2.1 Der direkte und der reziproke piezoelektrische Effekt.- 2.2 Die Entdeckung der Piezoelektrizität.- 2.3 Entwicklung der technischen Anwendung der Piezoelektrizität.- 2.4 Entwicklung der Theorie des piezoelektrischen Effektes.- 3 Grundlagen der phänomenologischen Kristallphysik.- 3.1 Die Struktur der Kristalle.- 3.1.1 Die Symmetrieeigenschaften des Translationsgitters.- 3.1.2 Bravais-Gitter.- 3.1.3 Raumgruppen.- 3.1.4 Symmetrieklassen.- 3.2 Einführung in die Tensorrechnung.- 3.2.1 Skalare und Vektoren.- 3.2.2 Die Beziehungen zwischen den Vektorkoordinaten in zwei verschiedenen Grundsystemen mit gemeinsamem Koordinatenursprung.- 3.2.3 Die kovarianten und kontravarianten Basisvektoren (Koordinaten).- 3.2.4 Die Metrik-Koeffizienten.- 3.2.5 Anschauliche Bedeutung der kontravarianten und kovarianten Koordinaten.- 3.3 Einige Anwendungen der Tensorrechnung in der Kristallphysik.- 3.3.1 Das reziproke Gitter und die Millerschen Indizes.- 3.3.2 Das kartesische Koordinatensystem.- 3.3.3 Dielektrische Permittivität als Beispiel eines Tensors zweiter Stufe.- 3.3.4 Tensoren p-tev Stufe.- 3.3.5 Symmetrischer und antisymmetrischer Tensor zweiter Stufe.- 3.3.6 Die Hauptachsentransformation von symmetrischen Tensoren zweiter Stufe.- 4 Elastische Eigenschaften der Kristalle.- 4.1 Der Verzerrungszustand.- 4.2 Der Spannungszustand.- 4.3 Das Hookesche Gesetz.- 4.4 Transformationsgleichungen für elastische Konstanten.- 4.5 Der Youngsche Modul und die Poissonsche Zahl.- 4.6 Thermodynamik der Deformation.- 5 Grundlagen der Thermodynamik der piezoelektrischen Kristalle.- 5.1 Dielektrische Eigenschaften.- 5.2 Innere Energie des elastischen Dielektrikums.- 5.3 Lineare Zustandsgieichungen.- 5.4 Materialkonstanten.- 5.5 Beziehungen zwischen den Materialkonstanten.- 5.6 Die piezoelektrischen Konstanten.- 5.7 Die vier Arten des piezoelektrischen Effektes.- 5.8 Der piezoelektrische Effekt und die Kristallsymmetrie.- 5.9 Transformationsgleichungen für piezoelektrische Konstanten.- 5.10 Der pyroelektrische Effekt.- 5.11 Der hydrostatische piezoelektrische Effekt.- 5.12 Ferroelektrizität.- 5.12.1 Besondere Eigenschaften der Ferroelektrika.- 5.12.2 Thermodynamische Theorie.- 5.12.3 Mikrophysikalisches Modell zur Erklärung der Ferroelektrizität.- 5.12.4 Antiferroelektrizität.- 5.13 Ferroika.- 5.14 Nichtlineare Effekte.- 5.14.1 Der elektrooptische Effekt.- 5.14.2 Die Elektrostriktion 9.- 5.14.3 Der elektroelastische Effekt.- 5.14.4 Elastische Konstanten dritter Ordnung.- 6 Piezoelektrische Materialien.- 6.1 Allgemeine Anforderungen an piezoelektrische Materialien für Aufnehmer.- 6.2 Quarz.- 6.2.1 Wahl des Koordinatensystems.- 6.2.2 Physikalische Eigenschaften.- 6.2.3 Synthetische Quarzkristalle.- 6.2.4 Zwillingsbildung.- 6.2.5 Unterdrückung der sekundären Zwillingsbildung.- 6.2.6 Temperaturabhängigkeit der piezoelektrischen Konstanten.- 6.2.7 Nichtlineare elektromechanische Eigenschaften des ?-Quarzes.- 6.2.8 Piezoelektrische Eigenschaften des ?-Quarzes.- 6.3 Turmalin.- 6.4 Einige andere piezoelektrische Einkristalle.- 6.5 Piezoelektrische Texturen.- 6.5.1 Piezoelektrische Keramiken.- 6.5.2 Piezoelektrizität in dünnen Schichten von Polymeren.- 7 Grundbegriffe der piezoelektrischen Meßtechnik.- 7.1 Wahl der Begriffe und Definitionen.- 7.2 Definition eines Aufnehmers.- 7.3 Meßtechnische Eigenschaften der Aufnehmer.- 7.3.1 Statische Eigenschaften.- 7.3.1.1 Eigenschaften, die sich auf die Meßgröße beziehen.- 7.3.1.2 Eigenschaften der Beziehung zwischen Meßgröße und Ausgangssignal.- 7.3.1.3 Einflüsse der Temperatur auf die Beziehung zwischen Meßgröße und Ausgangssignal.- 7.3.1.4 Einflüsse von Beschleunigung, Vibration und Schock auf die Beziehung zwischen Meßgröße und Ausgangssignal.- 7.3.2 Dynamische Eigenschaften.- 7.3.3 Elektrische Eigenschaften.- 7.3.4 Einflüsse der Aufnehmermontage.- 7.3.5 Lebensdauer des Aufnehmers.- 7.3.6 Übersprechen.- 8 Piezoelektrische Aufnehmer.- 8.1 Einführung.- 8.2 Grundsätzliches zur Kraftmessung.- 8.3 Prinzipieller Aufbau der Aufnehmer.- 8.4 Allgemeine Übersicht über den praktischen Aufbau der Aufnehmer.- 8.5 Bauteile der Aufnehmer.- 8.5.1 Aufnehmerelemente.- 8.5.1.1 Quarz.- 8.5.1.2 Turmalin.- 8.5.1.3 Piezoelektrische Keramiken.- 8.5.2 Elektroden.- 8.5.3 Isolationsmaterialien.- 8.5.4 Vorspannelemente.- 8.5.5 Aufnehmergehäuse.- 8.5.6 Stecker.- 9 Aufnehmer für Kräfte und Momente.- 9.1 Allgemeines.- 9.2 Aufnehmer für Kräfte.- 9.3 Mehrkomponenten-Kraftaufnehmer.- 9.4 Aufnehmer für Momente.- 9.5 Meßtechnische Besonderheiten von Ein- und Mehrkomponenten-Kraftmeßsystemen.- 9.6 Einbau von Kraftaufnehmern.- 9.7 Sechskomponenten-Kraftmessung.- 9.8 Grundlagen der Kalibrierung von Kraftaufnehmern.- 10 Druckaufnehmer.- 10.1 Allgemeines.- 10.2 Aufbau piezoelektrischer Druckaufnehmer.- 10.3 Niederdruck-Aufnehmer.- 10.4 Druckaufnehmer für allgemeine Anwendungen.- 10.5 Hochdruck-Aufnehmer.- 10.6 Druckaufnehmer mit Beschleunigungskompensation.- 10.7 Druckaufnehmer für hohe Temperaturen.- 10.8 Druckaufnehmer für plastische Massen.- 10.9 Grundlagen der Kalibrierung von Druckaufnehmern.- 11 Beschleunigungsaufnehmer.- 11.1 Allgemeines.- 11.2 Grundlegende Eigenschaften von Beschleunigungsaufnehmern.- 11.3 Bauformen piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer.- 11.4 Besondere Eigenschaften von Beschleunigungsaufnehmern mit Aufnehmerelementen aus Turmalin oder piezoelektrischen Keramiken.- 11.5 Hochempfindliche Beschleunigungsaufnehmer.- 11.6 Beschleunigungsaufnehmer für allgemeine Anwendungen.- 11.7 Beschleunigungsaufnehmer für Schockmessungen.- 11.8 Beschleunigungsaufnehmer für hohe Temperaturen.- 11.9 Grundlagen der Kalibrierung von Beschleunigungsaufnehmern.- 12 Verstärker für piezoelektrische Aufnehmer.- 12.1 Elektrische Grundlagen.- 12.1.1 Elektrische Ladung.- 12.1.2 Entladung eines Kondensators, Zeitkonstante, Isolationswiderstand.- 12.1.3 Untere Grenzfrequenz eines RC-Gliedes.- 12.1.4 Meßnullpunkt.- 12.2 Der ideale Elektrometerverstärker.- 12.3 Der reale Elektrometerverstärker.- 12.4 Der ideale Ladungsverstärker.- 12.5 Der reale Ladungsverstärker.- 12.5.1 Empfindlichkeitseinstellung, Maßstab und Meßbereich.- 12.5.2 Untere Grenzfrequenz des Ladungsverstärkers.- 12.5.3 Rückstellung und Nullpunktswahl beim Ladungsverstärker.- 12.5.4 Obere Grenzfrequenz.- 12.5.5 Quasistatisches Messen, Stabilität und Drift.- 12.5.5.1 Zeitkonstante des Gegenkopplungskreises.- 12.5.5.2 Dielektrische Nachwirkung im Gegenkopplungskondensator.- 12.5.5.3 Eingangsleckstrom.- 12.5.5.4 Nullpunktsstabilität.- 12.5.5.5 Leckströme über die Isolationswiderstände im Eingangskreis infolge Offsetspannungen.- 12.5.5.6 Ausgangsspannung bei schlechter Eingangsisolation und kurzer Zeitkonstante.- 12.5.5.7 „Operate“-Sprung.- 12.5.5.8 Ladungsausgleich nach Manipulationen am Meßkreis.- 12.5.5.9 „Teildefekte“des MOS-FET am Verstärkereingang.- 12.5.6 Kabeleinfluß.- 12.5.7 Eigenschaften der heute gebräuchlichen Eingangsstufen.- 12.5.8 Kapazitive Kopplung für Messungen bei hohen Temperaturen.- 12.5.9 Schutz des MOS-FET-Eingangs vor Überspannung.- 12.5.10 Kalibrierung von Ladungsverstärkern.- 12.6 Kabel und Stecker.
1997-2026 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa