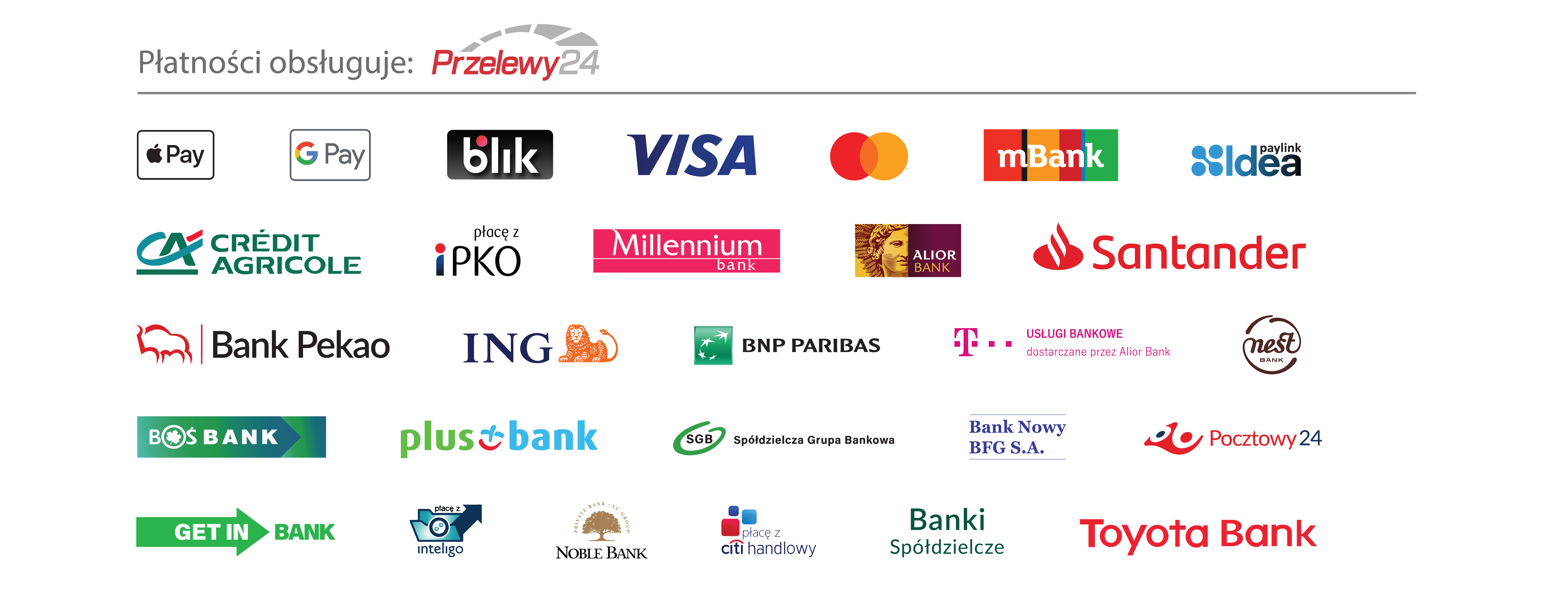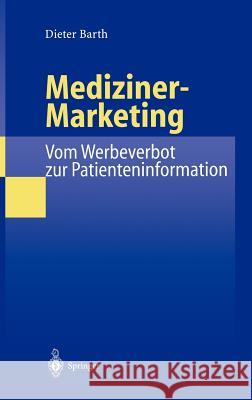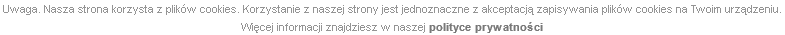Mediziner-Marketing: Vom Werbeverbot zur Patienteninformation: Eine rechtsvergleichende und interdisziplinäre Studie zur Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten » książka


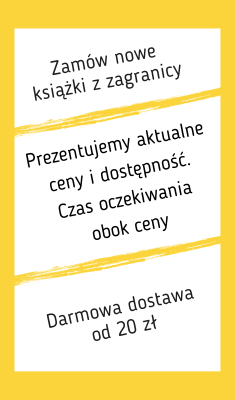
Mediziner-Marketing: Vom Werbeverbot zur Patienteninformation: Eine rechtsvergleichende und interdisziplinäre Studie zur Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten
ISBN-13: 9783540657484 / Niemiecki / Twarda / 1999 / 588 str.
Mediziner-Marketing: Vom Werbeverbot zur Patienteninformation: Eine rechtsvergleichende und interdisziplinäre Studie zur Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten
ISBN-13: 9783540657484 / Niemiecki / Twarda / 1999 / 588 str.
(netto: 395,02 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 396,31 zł
ok. 22 dni roboczych
Bez gwarancji dostawy przed świętami
Darmowa dostawa!
Wie kann ein Patient den f r sein gesundheitliches Problem richtigen Arzt finden? In einem komplexen Gesundheitswesen wird die Suche des Patienten seit langem durch Werbebeschr nkungen im Standesrecht f r rzte erschwert. Immer mehr rzte wollen ber ihr spezielles Angebot informieren d rfen; immer mehr Patienten verlangen nach Informationen ber die Qualit t der Mediziner. Der Brennpunkt f r die Kommunikation zwischen Patienten und rzten ist das Patientengrundrecht auf freie Arztwahl, denn nur ein informierter Patient kann seinen Arzt frei und selbstbestimmt w hlen. Das Buch entwirft unter Ber cksichtigung juristischer, medizinischer und konomischer Aspekte einschlie lich im Ausland gesammelter Erfahrungen ein Konzept f r eine patientenorientierte Informationsmedizin in einer Informationsgesellschaft.
§ 1 Einleitung und Gang Der Darstellung.- A. Einleitung.- I. Freie Berufe und „Werbung“.- II. Arzt und „Werbung“ — ein unlösbarer Widerspruch?.- III. Der Wandel der Medizin aus der Patientenperspektive.- IV. Der Wandel der Medizin aus der Arztperspektive.- V. Anforderungsprofil an eine moderne Arzt-Patient-Kommunikation.- B. Gang Der Darstellung.- 1. Teil: Werbebeschränkungen Für Ärzte in Ausländischen Rechtsordnungen.- § 2 Werbebeschränkungen Im Amerikanischen Recht.- A. Heilberufe Als Freie Berufe Im Gesundheitswesen.- I. Merkmale freier Berufe.- 1. Spezialwissen aufgrund besonderer Ausbildung.- 2. Zusammengehörigkeit und Kollegialität.- 3. Selbstverwaltung.- 4. Erfordernis staatlicher Zulassung.- 5. Besondere Berufsauffassung.- II. Struktur der amerikanischen Heilberufe.- 1. Zugehörige Berufsgruppen.- 2. Ausbildung.- 3. Weiterbildung.- III. Struktur des amerikanischen Gesundheitswesens.- 1. Besondere Kennzeichen.- a) Fehlende Gesetzliche Krankenversicherung.- b) Medicare und Medicaid.- c) Explodierende Gesundheitskosten.- d) Dominanz privater Anbieter.- e) Wettbewerb der Leistungserbringer.- 2. Aufkommen von Managed Care.- a) Health Maintenance Organizations.- b) Preferred Provider Organizations.- c) Auswirkungen auf Ärzte.- d) Auswirkungen auf Patienten.- 3. Reformansätze.- a) Scheitern der staatlichen Gesundheitsreform.- b) Ansätze zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens.- IV. Fazit.- B. Entwicklung Der Werbebeschränkungen.- I. Werbeformen.- 1. Advertising.- 2. Solicitation.- II. Geschichte des ärztlichen Standesrechts in den Vereinigten Staaten.- 1. Staatliche Regulierungen.- 2. Gründung erster Standesorganisationen.- 3. American Medical Association (AMA).- III. Werbebeschränkungen durch Standesrecht.- 1. Staatliche Beschränkungen.- 2. Standesrichtlinien der American Medical Association.- 3. Durchsetzung des Werbeverbotes.- C. Werbebeschränkungen und Kartellrecht.- I. Anwendbarkeit des Kartellrechts auf freie Berufe.- 1. Sherman Act als Grundlage des Antitrust-Rechts.- 2. Freie Berufe als kartellrechtlicher Ausnahmebereich.- 3. Die Entscheidung Goldfarb v. Virginia State Bar.- 4. Auswirkungen auf die Heilberufe.- a) Keine Ausnahme der Heilberufe vom Kartellrecht.- b) Beeinflussung des zwischenstaatlichen Handels.- c) Staatliche Wettbewerbsbeschränkungen.- II. Federal Trade Commission (FTC).- 1. Aufgaben und Struktur.- 2. Befugnisse.- 3. Werbung als Wettbewerbsinstrument.- 4. FTC und Werbebeschränkungen Freier Berufe.- a) Staatliche Werbeverbote.- b) Werbeverbote von privaten Standesorganisationen.- 5. Vorgehen der FTC gegen die AMA.- a) Untersagung des Werbeverbotes.- b) Reaktionen der Standesorganisationen.- c) Bestätigung der FTC durch die Bundesgerichte.- 6. Grenzen der Werbung.- III. Fazit.- D. Werbebeschränkungen und Verfassungsrecht.- I. Grundrecht auf freie Meinungsäußerung.- II. Anwendbarkeit auf Wirtschaftswerbung.- 1. Entwicklung der „commercial-speech-doctrine“.- 2. Die Entscheidung Virginia Pharmacy.- a) Verfassungsrechtlicher Schutz und Funktion der Werbung.- b) Recht des Verbrauchers auf Information.- c) Zulässigkeit von Schranken.- III. Die Entscheidung Bates v. State Bar of Arizona.- 1. Sachverhalt.- 2. Die Entscheidung des U.S. Supreme Court.- a) Rechtfertigungsgründe für eine Beschränkung.- (1) Erhaltung des Berufsbildes.- (2) Immanente Irreführung.- (3) Unerwünschte Steigerung der Nachfrage.- (4) Nachteilige ökonomische Effekte.- (5) Qualitätsverluste.- (6) Fehlende Kontrollmöglichkeiten.- b) Ergebnis der Abwägung.- c) Reichweite und Bedeutung der Entscheidung.- IV. Verfassungsrechtlicher Schutzumfang der Wirtschaftswerbung.- 1. Schutzbereich und Schranken der Gegenwart.- 2. Zulässigkeit staatlicher Beschränkungen.- 3. Anwendung auf Heilberufe.- E. Werbebeschränkungen in Der Gegenwart.- I. Grundlagen nach den Entwicklungen im Kartell-und Verfassungsrecht.- 1. Schutz der Freiheit von informativer Werbung.- 2. Abgrenzungskriterien „false, misleading, or deceptive“.- a) Funktion.- b) Verbotsumfang.- c) Substantiierung und Nachprüfbarkeit von Werbebehauptungen.- d) Schutz besonders gefährdeter Verbraucher.- e) Leitbild des mündigen Verbrauchers.- 3. Interpretationen der Standesorganisationen.- II. Zulässige Informationen in der Werbung.- 1. Verhältnis von Qualitäts-und Preisinformationen.- 2. Qualitätsinformationen.- a) Qualitätsmaßstäbe der medizinischen Dienstleistung.- b) Qualitätsmerkmale.- (1) Behandlungserfolge.- (2) Patientenzufriedenheit.- c) Zeugnisse ehemaliger Patienten.- d) Direkte Vergleichbarkeit von Ärzten.- 3. Qualifikation des Arztes.- a) Stationen der Ausbildung.- b) Angabe von Weiterbildungs-und Spezialisienmgsbezeichummgen.- (1) Nachgewiesene Qualifikationen.- (2) Spezialisierung ohne Nachweis.- (3) Nachweis der Fortbildung.- 4. Leistungsangebot.- a) Allgemeine Informationen.- b) Tätigkeitsgebiet und Praxisausstattung.- c) Besonderheiten und zusätzliche Leistungen.- d) Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern.- 5. Preisinformationen.- a) Angabe der Honorarsätze.- b) Krankenversicherung.- 6. Sanktionen.- III. Werbeformen.- 1. Praxisbroschüren.- 2. Anzeigen in den Gelben Seiten.- 3. Direktansprache von Patienten.- a) Gefahrenpotentiale und Regelungsmöglichkeiten.- b) Direkte persönliche Ansprache.- c) Direkte Zusendung von Werbeinformationen.- (1) Zusendungen allgemeiner Informationen.- (2) Zielgruppenspezifische Informationen.- d) Telefonwerbung.- e) Werbung zu besonderen Themen.- f) Bedeutung fir die Heilberufe.- 4. Auftreten in den Medien.- a) Verhältnis zur Öffentlichkeit.- b) Werbung in Rundfunk und Fernsehen.- 5. Verzeichnisse und Datenbanken.- a) Funktion.- b) Leistungsverzeichnisse.- c) Informationen über den ärztlichen Leistungserbringer.- IV. Tatsächliche Werbung von Ärzten.- 1. Beispiele für Werbung.- 2. Vorbehalte der Ärzte.- V. Kontrolle und Überwachung.- VI. Entwicklungen in der anwaltlichen Werbung.- 1. Krise des Justizwesens.- 2. Unterschied zum Gesundheitswesen.- F. Zusammenfassung.- § 3 Werbebeschränkungen und Europäisches Recht.- A. Werbebeschränkungen in Der Europäischen Union.- I. Deutschland.- II. Österreich.- III. Großbritannien.- IV. Weitere europäische Staaten.- V. Fazit.- B. Europäisches Gesundheits-und Verbraucherschutzrecht.- I. Gesundheitswesen.- 1. Gesundheitswesen als neues Ziel der Gemeinschaftspolitik.- 2. Auswirkungen auf das deutsche Gesundheitswesen.- a) Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung.- b) Grenzüberschreitende Versorgung im Krankenversicherungsrecht.- (1) Kooperation der Krankenversicherungen.- (2) Rechtsprechung des EuGH zur Behandlung im Ausland.- II. Verbraucherschutz.- 1. Verbraucherschutz durch Verbraucherinformation.- 2. Leitbild des mündigen Verbrauchers.- 3. Richtlinie zur irreführenden und vergleichenden Werbung.- 4. Werbeverbote als Instrument des Verbraucherschutzes.- III. Fazit.- C. Werbebeschränkungen und Grundfreiheiten.- I. Niederlassungsfreiheit.- II. Dienstleistungsfreiheit.- 1. Schutzumfang.- 2. Beschränkung der Freiheit.- 3. Möglichkeiten einer Rechtfertigung.- 4. Auswirkungen der Rechtsprechung zur Warenverkehrsfreiheit.- 5. Inländerdiskriminierung und Internationales Wettbewerbsrecht.- III. Fazit.- D. Zusammenfassung.- 2. Teil: Rahmenbedingungen in Deutschland Für Die Kommunikation Zwischen Patienten und Ärzten.- § 4 Entwicklung Der Patientenrechte.- A. Kommunikative Wandlungen Im Arzt-Patient-Verhältnis.- I. Paternalismus.- II. Partnerschaft.- 1. Entwicklung der Patientenautonomie.- 2. Patientenautonomie in der Praxis.- a) Geringe Akzeptanz der Ärzteschaft.- b) Wachsendes Informationsbedürfnis der Patienten.- III. Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- B. Patientenrechte.- I. Funktion.- 1. Schutz des Individuums.- 2. Mitgestaltung im Gesundheitswesen.- II. Ausprägungen.- III. Kodifizierung von Patientenrechten.- 1. Transformation von Arztpflichten in Patientenrechte.- 2. Stärkung der Patientenposition.- 3. Europäische Patientenrechtsdeklarationen der WHO.- C. Das Patientenrecht Auf Information.- I. Inhalt.- II. Beschränkungen.- D. Das Patientenrecht Auf Freie Arztwahl.- I. Freie Arztwahl als Teil des Selbstbestimmungsrechts.- II. Funktion der freien Arztwahl.- 1. Freie Arztwahl im Arzt-Patient-Verhältnis.- 2. Abgrenzung zur freien Arztwahl im Krankenversicherungsrecht.- III. Funktion der Aufldärung und Einwilligung.- IV. Patienteninformationen als Entscheidungsgrundlage.- 1. Anforderungen an die Information.- 2. Gestaltung der Kommunikation.- a) Aufklärung und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- V. Praktische Entscheidungssituationen.- 1. Aufklärung und Einwilligung.- 2. Freie Arztwahl.- a) Erstkontakt als langfristige Entscheidung.- b) Überweisung.- c) Ortswechsel oder Unzufriedenheit.- 3. Fazit.- VI. Verfassungsrechtliche Gewährleistung.- 1. Schutzbereich.- a) Garantie der Selbstbestimmung.- b) Schutz vor Gefährdungen.- 2. Eingriffe in die Arzt-Patient-Kommunikation.- a) Eingriff bei Behandlung ohne Aufklärung.- b) Gefährdung bei Arztwahl ohne Patienteninformation.- (1) Arztwahl als Grundrechtsgefähnmg.- (2) Umfang der Patienteninformation.- c) Subjektive Entscheidungskriterien.- d) Anforderungen an die Wahlfreiheit.- 3. Schutzpflicht.- 4. Schranken.- 5. Straf-und zivilrechtliche Rechtsfolgen.- 6. Fazit.- VII. Konkretisierung von Patienteninformationen fir Einwilligung und freie Arztwahl.- 1. Diagnose und Verlauf.- a) Aufklärung und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 2. Risiken.- a) Aufklärung und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 3. Behandlungsalternativen.- a) Aufklärung und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 4. Umfang.- a) Aufklärung und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 5. Zeitpunkt.- a) Aufklänmg und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 6. Verzicht.- a) Aufklärung mid Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 7. Abgrenzung zu anderen Informationspflichten.- a) Aufklärung und Einwilligung.- b) Freie Arztwahl.- 8. Fazit.- VIII. Gewährleistung im ärztlichen Berufsrecht.- 1. Internationales Standesrecht.- a) Weltärztebund.- b) Patientenrechte in der revidierten Deklaration von Lissabon.- 2. Amerikanisches Standesrecht.- 3. Deutsches Standesrecht.- a) Berufsordnung.- b) Programme.- 4. Fazit.- IX. Verhältnis von freier Arztwahl und Werbebeschränkungen.- 1. Gemeinsame Informationsgrundlage.- 2. Formelle Kompetenz zur Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts.- 3. Materielle Eingriffe durch ärztliches Berufsrecht.- a) § 27 MBO-Ä: Generelles Verbot der Werbung.- b) Kapitel D. I. Nr. 1 MBO-Ä: Information anderer Ärzte.- c) Kapitel D. I. Nr. 2, 3 MBO-Ä: Praxisschilder und Verzeichnisse.- d) Kapitel D. I. Nr. 5 MBO-Ä: Patienteninformation in den Praxisräumen.- e) Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- 4. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung.- a) Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit.- b) Schutz der Volksgesundheit.- c) Inhaltsbestimmung der Volksgesundheit.- E. Zusammenfassung.- § 5 Entwicklung Des Gesundheitswesens.- A. Veränderungen Der Versorgungsstrukturen.- I. Organisationsformen ärztlicher Leistungserbringer.- 1. Gemeinsame Berufsausübung.- a) Vorteile für den Arzt.- b) Freiberufliche Kooperationen.- c) Ärzte als Angestellte.- 2. Neue Kooperationsformen.- a) Partnerschaft.- b) Praxisnetze.- c) Heilkunde-GmbH.- II. Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung.- 1. Vorrang der ambulanten Behandlung.- 2. Ambulante Behandlung im Krankenhaus.- 3. Ambulantes Operieren.- 4. Belegarztwesen und Praxiskliniken.- 5. Kooperation bei Großgeräten.- 6. Verstärkte Notfallpräsenz.- 7. Fazit.- III. Neustrukturierung der ambulanten Versorgung.- 1. Dominanz der Fachärzte.- 2. Aufgaben der hausärztlichen Versorgung.- 3. Entwicklung zu integrierten Versorgungssystemen.- IV. Zögernde Umsetzung.- 1. Widerstände der Ärzteschaft.- 2. Strukturelle Defizite des Gesundheitswesens.- 3. Verteilungskämpfe organisierter Interessengruppen.- V. Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- 1. Zunahme von Angebot und Anbietern.- 2. Wachsende Bedeutung des Umfeldes.- VI. Konsequenzen für die Kommunikation im Arzt-Patient-Verhältnis.- 1. Informationsdefizite über Leistungsangebote.- a) Werbung von Kooperationsformen.- b) Werbung von verzahnten Versorgungsformen.- c) Werbung von ärztlichen Sanatorien und Kliniken.- (1) Bezeichnung als Klinik.- (2) Sanatoriums-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.- d) Werbung von Heilbehandlungs-GmbHs.- e) Werbung mit dem Umfeld.- 2. Notwendigkeit eines transparenten Leistungsangebotes.- a) Patienteninformationen über Strukturqualität.- b) Rolle des Patienten im Gesundheitswesen.- c) Gesundheitspolitische Erwägungen.- 3. Fazit.- B. System Der Krankenversicherung.- I. Gesetzliche und Private Krankenversicherung.- 1. Solidarprinzip - Risikoprinzip.- 2. Sachleistungsprinzip - Kostenerstattung.- II. Reform der Krankenversicherung.- 1. Finanzierungsprobleme.- a) Grundsatz der Beitragssatzstabilität.- b) Ursachen des Ausgabenzuwachses.- 2. Maßnahmen zur Kostenreduzierung.- a) Freie Wahl der Krankenkasse.- b) Eingrenzung des Leistungskataloges.- c) Prävention.- (1) Aufnahme in den Leistungskatalog.- (2) Gesundheitsökonomische Ambivalenz.- III. Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- C. Freie Arztwahl Als Systemsteuerung.- I. Freie Arztwahl im Krankenversicherungsrecht.- 1. Gesetzliche Krankenversicherung.- a) Historische Entwicklung.- b) Heutige Gewährleistung.- c) Einschränkungen.- 2. Private Krankenversicherung.- II. Einschränkung durch Primärarztmodell.- 1. Zielsetzung.- 2. Umfang.- a) Fehlender Nachweis der Wirtschaftlichkeit.- b) Praktisches Überweisungsverhalten der Hausärzte.- c) Verfassungsrechtliche Grenzen.- 3. Auswirkungen auf die Patienteninformation.- a) Notwendigkeit erhöhter Patienteninformation.- b) Freie Arztwahl als Wettbewerbsparameter.- III. Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- D. Weiterentwicklung Des Gesundheitswesens.- I. Veränderte Ziele.- 1. Selbstverwaltung statt staatlicher Eingriffe.- 2. Hochwertige Grundversorgung.- 3. Verhältnis Krankenversicherung - Ärzte.- 4. Mit-und Eigenverantwortung des Patienten.- II. Einbeziehung der Gesundheitsökonomie.- 1. Ökonomie als neue Kategorie ärztlichen Handelns.- 2. Anreize durch Vergütungssysteme.- a) Auswirkungen der Einzelleistungsvergütung.- b) Hinwendung zur pauschalierten Vergütung.- c) Qualitätsbezogene Vergütung.- III. Ganzheitliches Versorgungsmanagement.- 1. Stärkung der Allgemeinmedizin.- 2. Koordination durch Managed Care.- 3. Erprobung in Modellversuchen.- IV. Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- E. Zusammenfassung.- § 6 Patientenorientierung Durch Qualität.- A. Patientenorientierung Als Kundenorientierung.- I. Der Patient - ein Kunde?.- II. Qualität und Marketing als Mittel zur Patientenorientierung.- B. Qualitätsmanagement in Der Industrie.- I. Grundlagen.- 1. Qualitätsdefinition.- 2. Dienstleistungsqualität.- II. Qualitätsmanagement.- 1. Historische Entwicklung.- 2. Normen und Zertifikate.- a) Bedeutung.- b) Die Normenreihe DIN ISO 9000.- c) Vorteile und Nachteile einer Zertifizierung.- 3. Dynamisches Qualitätsmanagement.- a) Total Quality Management.- b) Instrumente.- III. Fazit.- C. Qualitätssicherung in Der Medizin.- I. Definition der medizinischen Qualität.- 1. Ethische, rechtliche und ökonomische Qualitätsvorgaben.- 2. Struktur-, Prozeß-und Ergebnisqualität.- a) Einteilung der Qualität.- b) Zusammenhänge.- c) Einfluß des medizinischen Fortschritts.- 3. Meßbarkeit von Qualität.- a) Mangelnde Objektivierbarkeit.- b) Meßmethoden.- 4. Indikatoren.- a) Qualitätsleitmerkmale.- b) Lebensqualität.- c) Patienten-Compliance.- d) Patientenzufriedenheit.- (1) Kriterien.- (2) Patientenbefragungen.- II. Grundlagen der medizinischen Qualitätssicherung.- 1. Historische Entwicklung.- 2. Vertrauensgut Medizin.- 3. Berufsständische Selbstkontrolle.- a) Berufsgerichtsbarkeit.- b) Defizite am Beispiel Suchtverhalten von Arzten.- 4. Zivilrechtliche Haftung.- 5. Funktion aus Patientensicht.- a) Gleichberechtigung des Patienten.- b) Qualitätssicherung als Patientengrundrecht.- 6. Bedeutung in der Gegenwart.- III. Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Ausland.- 1. WHO und Europarat.- 2. USA.- 3. Europäische Staaten.- IV. Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Deutschland.- 1. Maßnahmen des Gesetzgebers.- a) Verankerung im Gesundheits-Reformgesetz.- b) Zielsetzung.- c) Abgrenzung zur Wirtschaftlichkeitsprüfung.- 2. Maßnahmen der Ärzteschaft.- a) Ärztliches Berufsrecht.- b) Programme.- 3. Praktische Umsetzung.- a) Stationäre Versorgung.- b) Ambulante Versorgung.- (1) Schwerpunkt Strukturqualität.- (2) Defizite am Beispiel Zahnmedizin.- (3) Besonderheiten der ambulanten Qualitätssicherung.- 4. Qualitätszirkel.- a) Zielsetzung.- b) Arbeitsweise von Qualitätszirkeln.- c) Probleme bei der Realisierung.- V. Qualifikation der Mediziner.- 1. Ausbildung.- a) Inhalte.- b) Defizite.- 2. Weiterbildung.- a) Inhalte.- b) Defizite am Beispiel Schmerztherapie.- (1) Unterversorgung chronisch Schmerzkranker.- (2) Auseinandersetzung um die Zusatzbezeichnung „Schmerztherapie“.- (3) Konsequenzen aus der Perspektive des Patienten.- c) Andere fehlende Weiterbildungsgebiete.- d) Fehlende Rezertifizierung.- e) Konsequenzen fir die Patienteninformation.- 3. Fortbildung.- a) Methoden.- b) Einfluß der Industrie.- c) Keine Nachweispflicht.- d) Fortbildungsverhalten der Ärzteschaft.- e) Defizite.- 4. Anreize zur Qualitätssicherung.- a) Finanzierung.- b) Prinzip der Freiwilligkeit.- c) Modelle in anderen Staaten.- 5. Fazit.- VI. Konsequenzen fir die Patienteninformation.- D. Zusammenfassung.- § 7 Patientenorientierung Durch Marketing.- A. Marketing Als Ganzheitliches Konzept.- I. Entwicklung des Marketings.- 1. Verkaufsorientierung als historischer Ursprung.- 2. Marktorientierung auf Kundenbedürfnisse.- 3. Einbeziehung sämtlicher Unternehmensbereiche.- 4. Anwendung fir nichtkommerzielle Zwecke.- 5. Verhältnis zum Qualitätsmanagement.- II. Kommunikationspolitik als Teil des Marketings.- 1. Funktion.- 2. Instrumente 3.- a) Werbung.- b) Verkaufsförderung.- c) Öffentlichkeitsarbeit.- 3. Mißverständnisse über Marketing-Kommunikation.- B. Werbung Als Kommunikationsform.- I. Ökonomische Funktion der Werbung.- 1. Marktmechanismus und Werbung.- a) Grundelemente eines Marktes.- b) Werbung als Informationsinstrument der Marktteilnehmer.- 2. Werbung als Instrument der Marketingkommunikation.- a) Bekanntmachungs-und Erinnerungsfunktion.- b) Informationsfimktion.- c) Suggestivfunktion.- d) Wandel der Marketingkommunikation.- 3. Werbewirkung auf Konsumenten.- a) Informationsaufnahme.- (1) Persönliche Einflugfaktoren.- (2) Produktspezifische Einflugfaktoren.- (3) Mehrstufiger Entscheidungsprozeß.- b) Informationsverarbeitung.- (1) Selektive Wahrnehmung von Informationen.- (2) Verarbeitungsmodelle.- (3) Verhaltensbeeinflussung durch Werbung.- 4. Fazit.- II. Besonderheiten im Dienstleistungsmarketing freier Berufe.- 1. Marketing für Dienstleistungen.- a) Komplexes Kaufverhalten mit persönlichen Informationsquellen.- b) Kommunikationsformen fir Qualitätsinhalte.- 2. Freiberufliches Marketing.- a) Vertrauensmarketing.- b) Marketing-Funktion der Standesordmmgen.- 3. Freiberufliche Kommunikationspolitik.- a) Anforderungen an Werbung.- b) Mund-zu-Mund-Marketing.- 4. Fazit.- III. Rechtliche Beurteilung der Werbung.- 1. Verfassungsrechtliche Grundlagen.- a) Berufsfreiheit.- b) Meinungs-und Informationsfreiheit.- (1) Werbung als Form der Meinungsäußerung.- (2) Einfluß des Europäischen Gerichtshofs fir Menschenrechte.- (3) Informationsfreiheit als Verbrauchergrundrecht.- 2. Wettbewerbsrecht.- a) Anwendbarkeit des Wettbewerbs-und Kartellrechts auf Freiberufler.- b) Informationsrestriktionen als Wettbewerbsbeschränkung.- c) Verbraucherschutz.- d) Verbraucherleitbild.- e) Werbeverständnis der Rechtsprechung.- 3. Verfassungskonforme Bewertung der Werbung.- a) Werbung als Kommunikationsgrundrecht aller Marktteilnehmer.- b) Werbung als informativer Verbraucherschutz.- c) Vergleich mit dem amerikanischen Werbeverständnis.- 4. Fazit.- C. Marketing Im Gesundheitswesen.- I. Zeitalter des medizinischen Marketings.- 1. Wandel des Gesundheitsmarktes.- a) Wachsender Einfluß der Nachfrager.- b) Unzureichende Marktorientierung der Anbieter.- c) Marketing durch freie Arztwahl.- 2. Anforderungen an Mediziner-Marketing.- a) Ausrichtung an Bedürfnissen von Patienten und Gesellschaft.- b) Akzeptanz nur als Vertrauensmarketing.- c) Transparenzfördemde Ergänzung des Mund-zu-Mund-Marketings.- 3. Neuorientierung des medizinischen Wettbewerbsrechts.- a) Anpassung an Informationsbedürfnisse der Patienten.- b) Leitbild des mündigen Patienten.- II. Besonderheiten in der Struktur des Gesundheitsmarktes.- 1. Abweichungen vom Marktmodell.- a) Informationsdefizite der Patienten.- b) Fehlende Preissteuerung durch Versicherungsschutz.- c) Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage.- 2. Auswirkungen von Wettbewerb und Werbung im Gesundheitswesen.- a) Fehlende Entscheidungskompetenz des Patienten.- b) Steigerung der Leistungsnachfrage.- c) Wettbewerb auBerhalb der Kernkompetenzen.- d) Wettbewerb als Kostentreiber mit Risikoselektion.- 3. Bewertung.- a) Wettbewerb als Grundprinzip.- b) Berücksichtigung sozialer Zielsetzungen.- c) Flankierende Maßnahmen.- d) Vergleich zum amerikanischen Gesundheitswesen.- 4. Fazit.- III. Werbebeschränkungen zwischen Marketing und Qualitätssicherung.- 1. Schutz vor qualitätsmindernder Konkurrenz.- 2. Schutz vor unsachlichen Werbebehauptungen.- 3. Verhältnis von Werbung und Patienteninformation.- a) Funktionsorientierte Sichtweise.- b) Verfassungsrechtliche Fundierung.- c) Vergleich zu anderen Freiberuflern.- 4. Werbung im Gesundheitswesen.- a) Traditionelles Verständnis.- b) Modernes Verständnis.- D. Zusammenfassung.- 3. Teil: Patientenorientiertes Mediziner-Marketing.- § 8 Empirische Untersuchungen.- A. Erwartungen Der Patienten.- I. Patiententypen und ihre Informationsbedürfnisse.- 1. Individualität der Bedürfnisse.- 2. Hohe Informationserwartungen.- II. Anforderungsprofil an den Arzt.- III. Patientenzufriedenheit.- 1. Erfüllung der Patientenwünsche.- 2. Wahrnehmung der Patientenwünsche.- B. Kriterien Für Die Arztwahl.- I. Ablauf des Suchprozesses.- II. Wahl zwischen Allgemeinarzt und Facharzt.- III. Gründe fir einen Arztwechsel.- C. Werbung und Arztwahl.- I. Einstellung der Patienten.- II. Einstellungen der Ärzte.- 1. Vorbehalte gegen Patienteninformation.- 2. Zersplitterung der Ärzteschaft.- III. Untersuchungen zum tatsächlichen Werbeverhalten.- D. Zusammenfassung.- § 9 Patienteninformation und Ärztliche Berufsordnung.- A. Kommunikationsmodell Einer Patientenorientierten Informationsmedizin.- I. Vorgaben.- 1. Einflüsse anderer Rechtsordnungen.- 2. Patientenrecht auf freie Arztwahl als Teil des Selbstbestimmungsrechts.- 3. Patienteninformation über Qualität.- 4. Werbung als Kommunikationsform.- II. Zielsetzung.- 1. Garantie der freien Arztwahl im Gesundheitswesen.- 2. Patienteninformationen zur Steuerung des Gesundheitswesens.- 3. Patienteninformationen als Mittel zur Risikominimierung.- III. Gestaltung der Patienteninformation.- 1. Zielgruppen.- 2. Informationsinhalte.- 3. Informationsfluß.- B. Patientenorientiertes Qualitätsmarketing.- I. Qualitätsangaben.- 1. Persönliche Strukturqualität.- a) Person des Arztes.- b) Ausbildung.- c) Weiterbildung.- d) Fortbildung.- e) Bezeichnungen durch Fachgesellschaften.- (1) Notwendigkeit.- (2) Aufgaben der medizinischen Fachgesellschaften.- (3) Verhältnis zur Weiterbildung.- t) Nachweisbare Tätigkeitsschwerpunkte.- g) Interessenschwerpunkte aufgrund einer Selbsteinschätzung.- h) Bewertung.- 2. Sachliche Strukturqualität.- a) Direktes Leistungsangebot des Gesundheitsversorgers.- (1) Medizinische Praxisausstattung.- (2) Weitere Ausstattungsmerkmale.- (3) Besondere Dienstleistungen.- b) Praxisumfeld.- c) Zusammenarbeit mit Krankenversicherungen.- d) Einschränkungen.- (1) Wettbewerbsrecht.- (2) Kombination mit persönlicher Strukturqualität.- 3. Prozeß-und Ergebnisqualität.- a) Probleme der Darstellbarkeit.- b) Direkte qualitätsbezogene Aussagen in Einzelfällen.- II. Präsentationsformen.- 1. Zertifikate.- a) Funktionsweise.- b) Wegweiser filz Patienten.- c) Anforderungen.- (1) Orientierung an internationalen Qualitätsmaßstäben.- (2) Dynamisierung und Befristung.- d) Konkrete Umsetzung.- (1) Stationärer Bereich.- (2) Einzelinformationen über sachliche Strukturqualität.- (3) Zertifikate für umfassendes Qualitätsmanagement.- e) Zertifikate als Ausdruck von Qualitätsdefiziten.- 2. Ärzte-Tests und Rankings.- a) Methodische Probleme am Beispiel der Focus-Ärzteserien.- b) Bewertung.- 3. Praxisdarstellung.- a) Praxisbroschüre.- b) Präsenz im Internet.- 4. Einzelfragen.- a) Direktansprache.- b) Auftritt in den Medien.- c) Verwendung eines Logos.- d) Weitere Maßnahmen des kommunikativen Marketing-Mixes.- III. Informationsquellen.- 1. Ärztliche Selbstverwaltung.- a) Bisherige Aufgaben der Ärztekanmiem.- b) Zukunftsaufgaben der Kammern bei der Patienteninformation.- 2. Nichtärztliche Institutionen.- a) Gründung einer „Stiftung Medizinertest“.- b) Beratungsstellen filz Patienten.- 3. Informationssysteme.- IV. Anreize zum umfassenden Qualitätsmanagement.- 1. Transparenz gegenüber dem Patienten.- 2. Anreiz über Vergütungssysteme.- a) Honorierung für Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung.- b) Einbeziehung von Qualitätszielen.- C. Konsequenzen Für Die Ärztlichen Berufsordnungen.- I. Neufassung der selbstbestimmenden Kommunikationsvorschriften.- 1. Garantie der Patienteninformation als Qualitätsinformation.- 2. Koppelung an den Stand der Qualitätssicherung.- 3. Umwandlung in eine generelle Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt.- 4. Formulierung als Generalklausel.- II. Formulierungsvorschlag fir die Musterberufsordnung.- 1. Neufassung des § 8 MBO-Ä.- 2. Ergänzende Empfehlungen.- 3. Vergleich zur Heilmittelwerbung.- III. Risikoabwägung intensivierter Patienteninformation.- 1. Geringe Mißbrauchsgefahr.- 2. Risikopotential der Qualitätsdefizite.- D. Zusammenfassung.- § 10 Schlussbetrachtungen: Vom Werbeverbot Zur Patienteninformation.- Abkürzungsverzeichnis.
1997-2025 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa