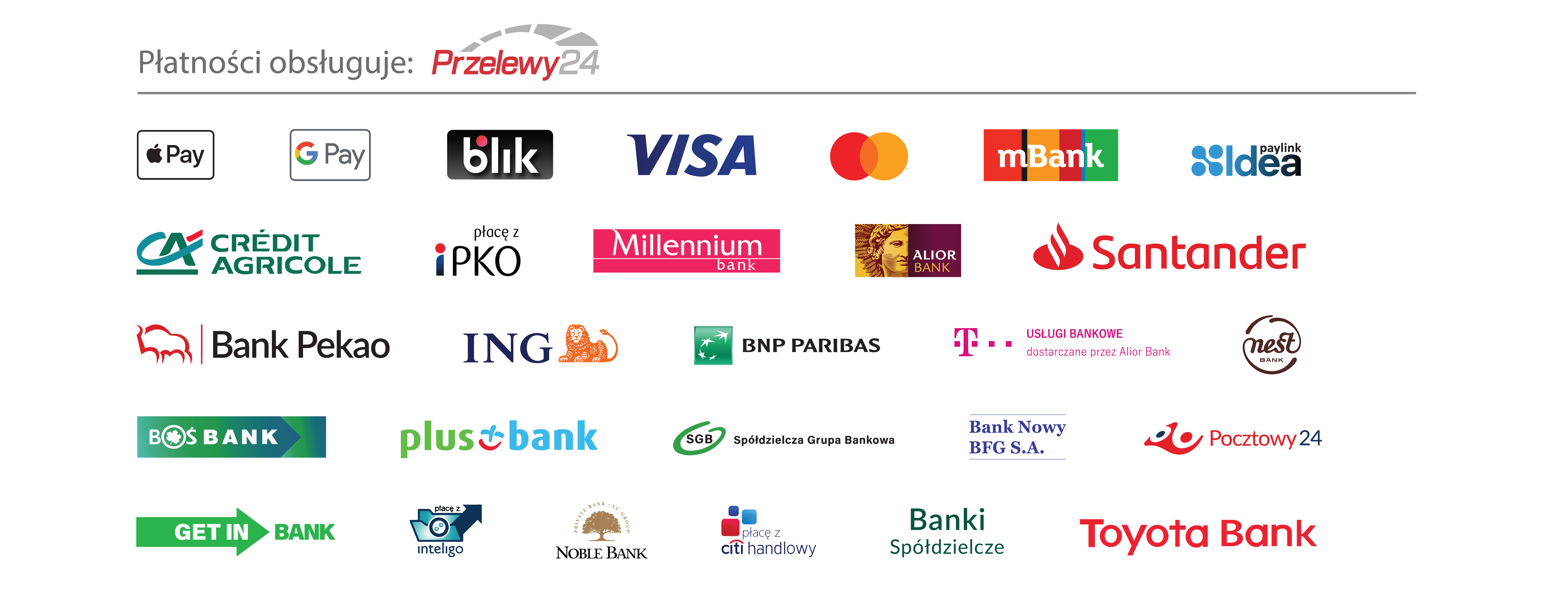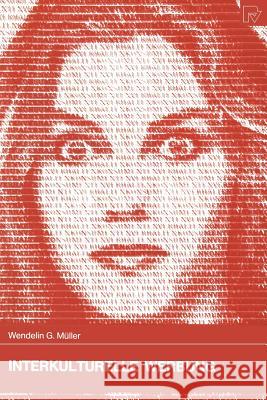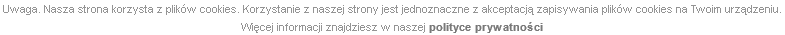Interkulturelle Werbung » książka


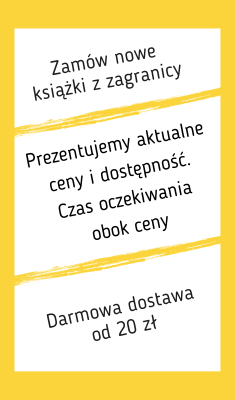
Interkulturelle Werbung
ISBN-13: 9783790809664 / Niemiecki / Miękka / 1996 / 292 str.
Interkulturelle Werbung
ISBN-13: 9783790809664 / Niemiecki / Miękka / 1996 / 292 str.
(netto: 183,90 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 193,10 zł
ok. 16-18 dni roboczych.
Darmowa dostawa!
Mit dem Ziel, den Grad der Standardisierbarkeit interkultureller Werbung genau zu quantifizieren, wird eine empirische Untersuchung vorgenommen. Hierzu werden die kommunikationstheoretischen und psychologischen Grundlagen der Werbung ausgearbeitet und in ein Modell der interkulturellen Werbung integriert. Der Einfluss von Kultur auf die Wirkung von Werbung wird genau operationalisiert. Die bisherigen Ansatze zur Werbestandardisierung werden umfassend empirisch dargestellt."
A. Einführung.- I. Ziel und Aufbau dieser Arbeit.- II. Die Standardisierungsdebatte.- 1. Kostendegression versus Berücksichtigung kultureller Besonderheiten.- 2. Argumente gegen die Standardisierung: Kulturelle Unterschiede verhindern eine erfolgreiche Werbestandardisierung.- 3. Argumente für die Standardisierung: Konvergenz der Kulturen führt zur Überwindung kultureller Unterschiede.- III. Diskussion der angebotenen Entscheidungshilfen.- 1. Erkenntnisse aus Analysen internationaler Werbung.- 1.1. Inhaltsanalysen.- 1.2. Strategieanalysen.- 2. Die Überwindung kultureller Unterschiede durch kulturunabhängige Aspekte der Werbung.- 2.1. Die Ansprache kulturübergreifender Marktsegmente.- 2.2. Die Werbestandardisierung für ‚kulturfreie‘ Produkte.- 2.3. Interkulturell universell verwendbare Werbebotschaften.- 3. Kompromißformeln: Kulturcluster und Dachkampagnen.- IV. Zusammenfassende Diskussion und Konkretisierung der Problemstellung.- B. Theoretische Grundlagen.- I. Diskussion der dieser Arbeit zugrundeliegenden Kulturdefinition.- 1. Klassische Kulturdefinitionen.- 2. Implizite versus explizite Kulturkonzeptionen.- 3. Entwicklung einer operationalen Kulturdefinition.- 3.1. Definition und Operationalisierung von Kultur anhand kultureller Variablen.- 3.2. Diskussion dieser Operationalisierung.- 4. Grundannahme über den kulturellen Einfluß auf das Verhalten: Universalismus.- 5. Festlegung der Untersuchungseinheit: Nation.- II. Rahmenbedingungen interkultureller Werbung.- 1. Universelle Kontexte: Gesättigte Märkte und Informationsüberlastung.- 2. Universelle Postulate: Emotionale Positionierung und Bildkommunikation.- 2.1. Erstes Postulat: Emotionale Positionierung.- 2.2. Zweites Postulat: Bildkommunikation.- III. Zum ersten Postulat: Universelle und kulturelle Determinanten emotionaler Werbung.- 1. Gegenstand.- 1.1. Was ist unter emotionaler Werbung zu verstehen?.- 1.2. Die universellen Effekte basieren auf kulturspezifischen Anforderungen.- 2. Die Wirkungsweise emotionaler Werbung.- 2.1. Universeller Prozeß: Emotionale Produktdifferenzierung durch klassische Konditionierung.- 2.2. Kulturelle Einflüsse auf den Konditionierungsprozeß.- 2.2.1. Theoretische Basis: Neoklassische Konditionierung.- 2.2.2. Heuristische Annahme: Unterschiedliche kulturelle Affinitäten der Reize.- 3. Die Erklärung des emotionalen Erlebens.- 3.1. Die Bestimmung einer geeigneten Emotionstheorie.- 3.1.1. Universalistische Konzeption.- 3.1.1.1. Psychobiologische Emotionstheorie.- 3.1.1.2. Kritik an der psychobiologischen Emotionstheorie.- 3.1.1.3. Rückgriff auf die psychobiologische Emotionstheorie in der Werbung.- 3.1.2. Relativistische Konzeption.- 3.1.2.1. Kognitivistische Emotionstheorie.- 3.1.2.2. Kritische Diskussion der kognitivistischen Emotionstheorie.- 3.1.2.3. Rückgriff auf die kognitivistische Emotionstheorie in der Werbung.- 3.2. Kulturelle Determinanten des emotionalen Erlebens.- 3.2.1. Theoretische Grundlage: Soziologische Emotionstheorien.- 3.2.2. Rückgriff auf soziologische Emotionstheorien in der Werbung.- 3.2.3. Überblick: Kulturelle Variationen des emotionalen Erlebens.- 3.2.4. Konkretisierung: Kulturelle Gefühlsregeln.- 4. Die Bedeutung der Wissensrepräsentation für die Wahrnehmung der Werbung.- 4.1. Universalistische Annahmen.- 4.1.1. Grundannahme der Wissensrepräsentation: Assoziative Netzwerke.- 4.1.2. Konstruktivistische Konzeption: Schematheorie.- 4.1.3. Die Repräsentation von Emotionen.- 4.1.4. Die Relevanz der Schemaansprache für die Wirkung von Werbung.- 4.2. Kulturelle Determinanten der Wissensrepräsentation.- IV. Zum zweiten Postulat: Die interkulturelle Kommunikation von Bedeutung durch Bilder.- 1. Vorbemerkung zum Bedeutungskonzept dieser Arbeit.- 2. Bilder als Träger von Bedeutung.- 2.1. Bedeutungsvermittlung durch Bilder.- 2.2. Bildverstehen durch das Individuum.- 3. Kulturelle Einflüsse auf das Bildverstehen: Kodes sind kulturelle Konventionen.- V. Reduktion der Kulturfacetten auf relevante Variablen.- VI. Zusammenfassung des theoretischen Teils: Ein Modell der interkulturellen Werbewirkung.- 1. Zur Notwendigkeit einer modelltheoretischen Annahme.- 2. Kritik an existierenden Modellen: Kultur wird als eine „Black Box“ aufgefaßt.- 3. Entwicklung eines Modells der interkulturellen Werbewirkung.- 3.1. Basis: Das Modell der Wirkungspfade.- 3.2. Der Einfluß der Kultur auf den Prozeß der Einstellungsbildung.- 3.2.1. Der Prozeß der Einstellungsbildung.- 3.2.2. Spezifizierung des kulturellen Einflusses auf die Einstellungsbildung.- 3.3. Kulturelle Variationen in der Rezeptions- und Kaufsituation.- 3.3.1. Ausgangspunkt: Kulturell unterschiedliche dominante Wirkungsmuster.- 3.3.2. Unterschiede in der Rezeptionssituation.- 3.3.3. Unterschiede in der Kaufsituation.- 3.4. Zusammenfassung: Das Modell der interkulturellen Werbewirkung.- C. Empirischer Teil: Eine empirische Untersuchung interkultureller Übereinstimmungen der Determinanten der Werbewirkung.- I. Zielsetzung.- II. Ausgangspunkt: Operationalisierung der Fragestellung Das Stufenmodell der Standardisierung interkultureller Werbung.- 1. Die Standardisierung der Werbebotschaft.- 2. Die Standardisierung der Werbemittel.- 3. Die Affinität von Produkt und Positionierungskonzept.- III. Methodische Grundlagen.- 1. Die Auswahl des sprachlichen Verhaltens als Kulturindikator: Existiert eine sprachliche Relativität?.- 2. Methoden der Bedeutungsmessung.- 2.1. Das Semantische Differential (SD) zum Messen affektiver Wortbedeutung.- 2.1.1. Die Technik des SD.- 2.1.2. Die Bedeutungskomponenten: Was mißt das SD?.- 2.1.3. Kritik: Intervenierende Effekte.- 2.1.4. Die interkulturelle Validität des SD.- 2.1.5. Diskussion.- 2.1.6. Das Messen affektiver Bedeutungen.- 2.1.6.1. Maßzahlen zur Beschreibung Semantischer Differentiale.- 2.1.6.2. Maßzahlen zum Vergleich Semantischer Differentiale.- 2.2. Der Wortassoziationstest zum Messen assoziativer Bedeutung.- 2.2.1. Der Wortassoziationstest (WAT).- 2.2.2. Assoziation unter Imageryinstruktion.- 2.2.3. Die Reversibilität des Assoziationsprozesses.- 2.2.4. Diskussion der Angemessenheit des WAT.- 2.2.5. Das Messen der assoziativen Bedeutung durch den WAT.- 2.2.5.1. Maßzahlen zur Beschreibung von Assoziationsverteilungen.- 2.2.5.2. Maßzahlen zum Vergleich von Assoziationsverteilungen.- 2.2.5.2.1. Das Prinzip der Überlappung zweier Assoziationsverteilungen.- 2.2.5.2.2. Der in dieser Arbeit verwendete Überlappungskoeffizient.- 2.2.5.2.3. Wann ist ein interkultureller Überlappungskoeffizient hoch?.- 3. Methodologische Besonderheiten interkultureller Forschung.- 3.1. Die Emic-Etic-Unterscheidung.- 3.2. Die Äquivalenz der Erhebungsverfahren.- 3.2.1. Linguistische Äquivalenz.- 3.2.2. Funktionale und konzeptionelle Äquivalenz.- 3.2.3. Meßäquivalenz.- IV. Hypothesenformulierung und Operationalisierung.- 1. Forschungshypothesen.- 1.1. Hypothesen zur Standardisierung der zentralen Werbebotschaft.- 1.1.1. Hypothesengruppe HA zur interkulturellen Übereinstimmung der affektiven Bedeutung in Abhängigkeit von Konzeptattributen.- 1.1.2. Hypothesen HAP1 und HAP2 zur Übereinstimmung der affektiven Bedeutung in Abhängigkeit von Personenmerkmalen.- 1.2. Hypothesen zur Standardisierung der formalen Umsetzung.- 1.2.1. Hypothesengruppe HR zur interkulturellen Überlappung der visuell-referentiellen Bedeutung in Abhängigkeit von Konzeptattributen.- 1.2.2. Hypothesengruppe HRP zur Abhängigkeit der interkulturellen Überlappung der referentiellen Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen.- 1.2.3. Hypothesengruppe HRK zur interkulturellen Überlappung der visuell referentiellen Bedeutung in Abhängigkeit von Kulturmerkmalen.- 1.2.4. Hypothesengruppe HF zur Möglichkeit einer rein syntaktischen Standardisierung: Farbassoziationen.- 1.3. Die interkulturelle Affinität von Produkt und Positionierungsthema.- 1.4. Test der Praktikabilität des High-Tech/High-Touch-Modells.- 2.Verfahrenshypothesen.- 2.1. Hypothese HV1 zur Reduktion des Erhebungsaufwandes.- 2.2. Hypothesen HV2 — HV5 zum möglichen Rückgriff auf Sekundärdaten.- 2.3. Hypothesen HV6 und HV7 zum Modus der Erhebung.- V. Stimulusauswahl und Pretest.- 1. Stimulusauswahl.- 2. Pretest.- 2.1. Pretest des Semantischen Differentials.- 2.2. Pretest der Erhebungsdurchführung.- VI. Empirisches Vorgehen.- 1. Erhebungsorte und -zeiten.- 2. Probanden.- 3. Instruktionen und Durchführung.- VII. Gütekriterien der Messung.- 1. Reliabilität.- 1.1. Die Reliabilität des Semantischen Differentials.- 1.2. Die Reliabilität des Wortassoziationstests.- 1.3. Die Interkodier-Reliabilität.- 2. Validität.- 2.1. Die Validität des Semantischen Differentials.- 2.2. Die Validität des WAT.- VIII. Ergebnisse der Hypothesentests.- 1. Ergebnisse der Forschungshypothesen.- 1.1. Ergebnisse zur Standardisierung der zentralen Werbebotschaft.- 1.1.1. Ergebnisse zur interkulturellen Übereinstimmung der affektiven Bedeutung in Abhängigkeit von Konzeptattributen (Hypothesengruppe HA).- 1.1.2. Ergebnisse zu HAP1 und HAP2: Übereinstimmung/Personenmerkmale.- 1.1.3. Qualitative Analyse ausgewählter inhaltlicher Ergebnisse.- 1.2. Ergebnisse zur Standardisierung der formalen Umsetzung.- 1.2.1. Ergebnisse zur Hypothesengruppe HR: Überlappung/Konzeptattribute.- 1.2.2. Ergebnisse zur Hypothesengruppe HRP: Überlappung/Persönlichkeitsmerkmale.- 1.2.3. Ergebnisse zur Hypothesengruppe HRK: Überlappung/verglichene Kulturen.- 1.2.4. Ergebnisse zur Hypothesengruppe HF: Die Möglichkeit einer rein syntaktischen Standardisierung aufgrund übereinstimmender Farbassoziationen.- 1.2.5. Ausgewählte inhaltliche Unterschiede der referentiellen Bedeutungen.- 1.3. Ergebnisse zur interkulturellen Affinität von Produkt und Positionierungsthema.- 1.4. Test der Praktikabilität des High-Tech/High-Touch-Modells.- 2. Ergebnisse zu den Verfahrenshypothesen.- 2.1. Ergebnisse zu HV 1: Reduktion des Erhebungsaufwands.- 2.2. Ergebnisse zu HV2 bis HV5: Rückgriff auf Sekundärdaten.- 2.3. Ergebnisse zu HV6 und HV7: Ein Vergleich der Erhebungsverfahren.- 2.3.1. Quantitative Effekte.- 2.3.2. Experimentbeurteilung durch die Probanden.- 2.3.3. Der Computereinsatz in der interkulturellen Forschung.- IX. Generelle Möglichkeiten der Standardisierung interkultureller Werbung vor dem Hintergrund absoluter kultureller Differenzen.- 1. Beurteilung der Möglichkeiten, die zentrale Werbebotschaft zu standardisieren.- 2. Beurteilung der Möglichkeiten, die formale Umsetzung der Werbebotschaft zu standardisieren.- 3. Können interkulturelle Segmente standardisiert angesprochen werden?.- D. Anwendungsteil: Diskussion einer interkulturellen Erweiterung des Expertensystems Computer Aided Advertising System (CAAS).- I. Einführung: Expertensysteme im internationalen Marketing.- II. Die Ausgangsbasis: Computer Aided Advertising System.- III. Möglichkeiten und Grenzen einer interkulturellen Erweiterung des CAAS-Suchsystems.- 1. Zur CAAS-gestützten Entwicklung einer interkulturellen Positionierung.- 2. Zur CAAS-gestützten Entwicklung einer interkulturellen formalen Umsetzung der Werbebotschaft.- 3. Fazit: Ist eine CAAS-Erweiterung für interkulturelle Werbung sinnvoll?.- E. Schluß.- I. Zur Ausgangshypothese der kulturellen Konvergenz.- II. Grenzen und Implikationen des in dieser Arbeit verfolgten Ansatzes.- III. Eine zusammenfassende Beurteilung des Standardisierungsgedankens und einige Überlegungen zu dessen zukünftiger Relevanz.- Anhang I: Stimulusmaterial und Stichprobenbeschreibung.- Anhang II: Instruktionen und Fragebögen.- Anhang III: Kodierhilfen.- Anhang IV: Vergleich der Extremwerte ausgesuchter Variablen.- Anhang V: Beispiele zu den ausgewerteten Datensätzen.
1997-2025 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa