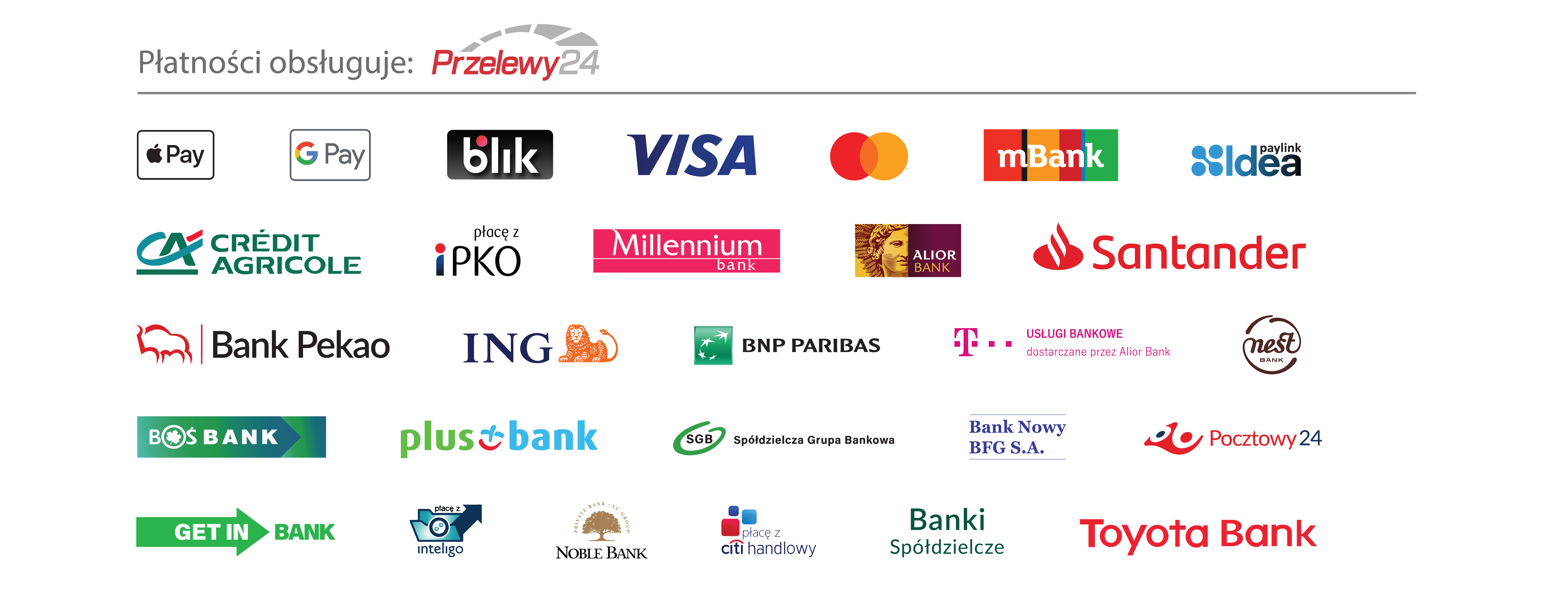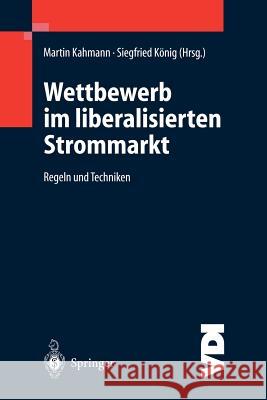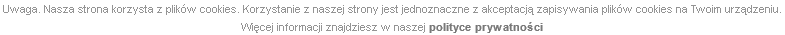Wettbewerb Im Liberalisierten Strommarkt: Regeln Und Techniken » książka


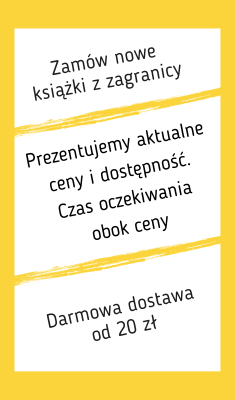
Wettbewerb Im Liberalisierten Strommarkt: Regeln Und Techniken
ISBN-13: 9783642640100 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 264 str.
Wettbewerb Im Liberalisierten Strommarkt: Regeln Und Techniken
ISBN-13: 9783642640100 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 264 str.
(netto: 179,12 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 180,14
ok. 22 dni roboczych.
Darmowa dostawa!
Deregulierung, Wettbewerb, freier Netzzugang mussen seit Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts umgesetzt werden. Die Energieversorger mussen den Wettbewerb beginnen und dabei einen gewaltigen (informations-) technologischen Wandel vollziehen. Dazu sind u.a. neue Abrechnungssysteme einzufuhren, die eine Schlusselrolle in diesem Wandel spielen. Dieses Buch zeigt das Instrumentarium zur Vermarktung der Stromprodukte: Regeln des Marketings fur die "Ware Strom", Einsatz moderner Mess- und Informationstechnik mit einem unternehmensubergreifenden Informationsmanagement vom Elektrizitatszahler bis zur Rechnungstellung, Selbstkontrolle auf Anbieterseite wie Verbandevereinbarung, Grid-Distribution-Metering Codes und Industrienormung, Vertretung von Nachfragerinteressen wie Verbrauchervereine, Rechtsnormen, wie das Energiewirtschafts-, Wettbewerbs- und Eichrecht.
I Einführung.- Der liberalisierte Strommarkt.- 1 Die deutsche Elektrizitätswirtschaft vor der Liberalisierung.- 2 Novellierung des energierechtlichen Rahmens.- 2.1 EU-Stromrichtlinie.- 2.2 Neufassung des deutschen Energiewirtschaftsgesetzes.- 2.3 Die kommunale Perspektive.- 2.4 Analogien zur Öffnung des Telekommunikationsmarktes.- 2.5 Vergleich mit Liberalisierungsprozessen ausländischer Strommärkte.- 3 Auswirkungen auf die Struktur der Elektrizitätswirtschaft.- 3.1 Umstrukturierung bestehender Stromversorgungsunternehmen.- 3.2 Neue Marktteilnehmer.- 3.3 Strombörsen.- 4 Regeln für den Strommarkt.- 5 Anforderungen an Informations- und Kommunikationstechnik.- 6 Entwicklungstendenzen.- Literatur.- II Marketing.- Vom Demand-Side Management zum Strategischen Marktmanagement im Strommarkt.- 1 Demand-Side Management im Rahmen des Least-Cost-Planning.- 1.1 Preisgestaltung und Lastmanagement.- 1.2 Direkte Förderung der Energieeinsparung.- 1.3 Informations- und Beratungsprogramme.- 1.4 Ergänzende Dienstleistungen.- 2 Kundenverhalten und Energiekonsum.- 3 Marktmanagement im liberalisierten Strommarkt.- 3.1 Segmentierungsstrategie.- 3.2 Präferenzstrategie.- 3.3 Kooperationsstrategie.- 4 Kundeninteresse und Verbraucherpolitik im liberalisierten.- Strommarkt.- Literatur.- Marketing-Instrumente zur Gewinnung und Bindung von Kunden.- 1 1998: Die Marktöffnung.- 2 Frühjahr 1999: Marketing, Marktforschung und Unternehmenskommunikation der Energieversorger.- 3 Winter 1999: Liberalisierung contra Wechselverhinderungsbarrieren? Die Unkenntnis der Verbraucher.- 4 1998 und 1999: Marketingmaßnahmen in Theorie und Praxis.- 4.1 Preisfindung.- 4.2 Dienstleistungsmerkmale (added values).- 4.3 Vertriebskanäle.- 4.4 Kommunikation: Werbung und PR.- 4.5 Kundenbindung und Wechselabsicht.- 5 2000: Ein Ausblick.- Literatur.- III Mess-, Informations- und Kommunikationstechnik.- Elektrizitätszähler und Zusatzeinrichtungen für Verrechnungszwecke.- 1 Segmentierung der Messanforderungen.- 2 Vor- und Nachteile der Messgerätetechnologien.- 2.1 Induktionsmotorzähler.- 2.2 Elektronischer Zähler.- 3 Anwendung.- 3.1 Wirkverbrauchmessung.- 3.2 Blindverbrauchmessung.- 3.3 Messung wechselnder Energierichtungen.- 4 Leistungsmessung.- 4.1 Lastgänge.- 4.2 Der Zähler als Marketingwerkzeug.- 5 Impulsverarbeitende Zusatzeinrichtungen.- 6 Prepaymentzähler.- 7 Spezifische Konzepte anderer EU-Länder.- 8 Anbindung der Verrechnungsmessung an die zentrale Zählwertverarbeitung.- 8.1 Impulsschnittstellen.- 8.2 Datenkommunikationsschnittstellen.- 9 Ausblick.- 10 Zusammenfassung.- Literatur.- Marktforschung: Beispiel Prepaymentzähler.- 1 Ausgangssituation.- 2 Marktforschung.- 2.1 Bedeutung der Marktforschung.- 2.2 Grundsätzliche Anmerkungen zur Marktforschung in liberalisierten Märkten.- 2.3 Informationsquellen.- 2.4 Marktforschungsdesign.- 2.5 Erhebung und Auswertung.- 3 Zählertechnologie Prepaymentzähler: Ergebnisse einer Studie.- 3.1 Methodik.- 3.2 Technologie Prepaymentzähler/Verfügbare Systeme.- 3.2.1 Chipschlüsselzähler.- 3.2.2 Nr.-Schlüsselzähler.- 3.2.3 (Chip-)Kartenzähler.- 3.3 Anwenderanforderungen.- 3.4 Weitere Ergebnisse mit PPM.- 3.5 Exkurs: Folgen für die Abrechnung.- 3.6 Markt und Trends.- 3.7 Chancen und Risiken neuer Zählertechnologie.- 3.8 Weiterer Ausblick.- 3.8.1 Die Bedeutung von neuen Zählertechnologien.- 3.8.2 Technologie- versus Marketinginvestements.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Kommunikationsmittel im Strommarkt.- 1 Einleitung.- 2 Kommunikationsaufgabe.- 3 Kommunikationstechnologien.- 3.1 Prozess.- 3.2 Markt.- 3.3 Zukunft.- 4 Kommunikation über das Internet.- 4.1 Sicherheit.- 4.2 Signatur.- 4.3 Leistung.- 5 Kommunikation über das Energienetz.- 5.1 Anwendung.- 5.2 CENELEC Normen und EMV.- 5.3 Technologie.- 5.4 Technische Systeme.- 5.5 Eigenschaften des Mediums.- 5.6 Gesetzlicher Rahmen.- 6 Prozesskommunikation.- 7 Marktkommunikation.- 7.1 Elektronischer Austausch von Fahrplänen.- 7.2 Zählerstandsübertragung.- 7.3 Schnittstelle für Zählwerte.- 7.4 Energiebörse.- 7.5 Kommunikation mit Privatkunden und Kleingewerbe.- 8 Kommunikationssystem.- Literatur.- Datenhaltung und Datenverarbeitung für die Marktkommunikation.- 1 Anforderungen des liberalisierten Strommarktes.- 2 Neue Strukturen in der Energieversorgung.- 2.1 Energieerzeugung.- 2.2 Energietransport/Energieverteilung.- 2.3 Energieabnehmer/Kunde.- 2.4 Strukturen der Verbrauchsmessung, Übertragung und Abrechnung.- 3 Konzeptionelle Grundlagen.- 3.1 Datenprotokolle.- 3.2 Datenelemente der Verbrauchsmessgrößen.- 4 Systemlösungen.- IV Wettbewerbliche Selbstregulierung.- Privatwirtschaftlich vereinbarte Regeln für den Strommarkt.- 1 Fahrplan der Liberalisierung der deutschen Elektrizitätswirtschaft.- 2 Die Netz-Codes.- 2.1 Schrittweise Vervollständigung und Weiterentwicklung des Regelwerkes.- 2.2 Der GridCode der Übertragungsnetzbetreiber.- 2.3 Die Kooperationsregeln für die deutschen Übertragungsnetzbetreiber.- 2.4 Metering Code.- 2.5 Der Verteilungsnetz-Code.- 3 Verbändevereinbarung 2.- 3.1 Wesentliche Verbesserung der Regelung im zweiten Wurf.- 3.2 Netznutzungsentgelte.- 3.2.1 Punktmodell.- 3.2.2 Handelszonen.- 3.2.3 Preisfindung.- 3.2.4 Netzkostenermittlung.- 3.3 Bereitstellung und Abrechnung von Ausgleichsenergie.- 4 Auswirkungen der Nicht-Regulierung.- Privatwirtschaftlich vereinbarte Standardisierung für den Strommarkt.- 1 Einführung.- 2 Auswirkungen des Strommarktes auf die Mess- und Zähltechnik.- 2.1 Zähler für Tarifkunden.- 2.2 Zähler für Sondervertragskunden.- 2.3 Zähler für Individualkunden.- 3 Standardisierungsgremien für Zähler.- 4 Energiedaten-Identifikationssystem (EDIS).- 5 Datenübertragungsprotokolle.- 6 VDEW-Lastenheft „Elektronische Elektrizitätszähler“.- Literatur.- V Privatwirtschaftlich organisierte Kundeninteressenvertretung.- Energieberatung für Sondervertragskunden beim Abschluss von Strombezugsverträgen.- 1 Begriffe und Größen in der Energiewirtschaft.- 2 Sonderverträge und Preisregelungen.- 3 Strompreisentwicklungen und-vergleiche.- 4 Bisherige Auswirkungen der Liberalisierung für Sondervertragskunden: Chancen und Risiken.- 5 Bündelung des Strombezuges.- 6 Beratungsmöglichkeiten beim Vertragsabschluss.- Organisierte Interessenvertretung der Tarifkunden/Verbraucher.- 1 Aufgaben der Verbraucheraufklärung und des Verbraucherschutzes im liberalisierten Strommarkt.- 2 Organisation, Ziele und Aufgaben der Stiftung Warentest.- 3 Dienstleistungen und vergleichende Untersuchungen.- 3.1 Untersuchungsdimensionen.- 3.2 Durchführung (Planung, Messung und Bewertung) der Dienstleistung.- 4 Untersuchungsbeispiele und deren Wirkung vor der Liberalisierung im Strommarkt.- 4.1 Verständlichkeit der Strom-, Gas- und Wasserabrechnungen — Problemstellung.- 4.2 Energiesparberatung.- 5 Preissenkungen und bessere Kundenorientierung als Folge der Liberalisierung im Strommarkt?.- 5.1 Marketing statt Kundenorientierung.- 5.2 Preiswettbewerb.- 6 Kundenorientierung — Realität oder Lippenbekenntnis? Welche Erwartungen bzw. Forderungen hat der Verbraucher?.- VI Staatliche Regulierung.- Tarifregulierung im liberalisierten Elektrizitätsmarkt.- 1 Einleitung.- 2 Anforderungen an den Wettbewerb auf leitungsgebundenen Märkten.- 2.1 Natürliche Monopole.- 2.2 Zugang zum Netz.- 2.3 Entflechtung.- 3 EU-Binnenmarktrichtlinie Strom.- 3.1 Hintergrund und Zielsetzung.- 3.2 Zentrale Inhalte der Richtlinie.- 3.2.1 Marktöffnungsschritte.- 3.2.2 Zugang zum Netz.- 3.2.2.1 Allgemeines.- 3.2.2.2 Netzzugang auf Vertragsbasis.- 3.2.2.3 Alleinabnehmer-System.- 3.2.3 Entflechtung und Transparenz.- 3.2.3 Weitere Regelungen.- 4 Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes.- 4.1 Hintergrund und Zielsetzung.- 4.2 Netzzugang.- 4.2.1 Übersicht.- 4.2.2 Verhandelter Netzzugang.- 4.2.3 Exkurs: Verhandlungs- vs. Regulierungslösungen.- 4.2.4 Netzzugangsalternative.- 4.2.5 Entflechtung.- 4.2.6 Anschluss- und Versorgungspflicht.- 4.3 Weitere Regelungen.- 5 Preisregulierung im liberalisierten Elektrizitätsmarkt.- 5.1 Übersicht.- 5.2 Aktuelle Marktentwicklung für Haushaltskunden.- 5.2.1 Netzzugang für Tarifkunden.- 5.2.1.1 Verbändevereinbarung I.- 5.2.1.2 Verbändevereinbarung II.- 5.2.2 Neue Stromangebote.- 5.3 Strompreisaufsicht.- 5.3.1 Grundlagen.- 5.3.2 Bundestarifordnung Elektrizität.- 5.3.3 Defizite der kostenorientierten Strompreisaufsicht.- 5.3.3.1 Systembedingte Defizite.- 5.3.3.2 Wettbewerbsbedingte Defizite.- 5.3.4 Fazit.- 5.4 Netzregulierung und Verbraucherschutz.- 5.4.1 Übersicht.- 5.4.2 Regulierung der Netznutzungsentgelte.- 5.4.3 Verbraucherschutz.- 5.4.3.1 Übersicht.- 5.4.3.2 Anschluss- und Versorgungspflicht.- 5.4.3.3 Gestaltung von Elektrizitätstarifen.- 5.4.3.4 Versorgungsbedingungen.- 6 Schlussbemerkung.- Literatur.- Eichrecht.- 1 Einführung.- 2 Wirtschaftspolitisches Ziel „Richtiges Messen“.- 3 Eichgesetz.- 3.1 Zweck des Eichgesetzes.- 3.2 Anordnungen des Eichgesetzes.- 3.2.1 Zulassung und Eichung von Messgeräten und Zusatzeinrichtungen, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden.- 3.2.2 Ermächtigung der Regierung, Durchführungs-Vorschriften zum Eichgesetz zu erlassen.- 3.2.3 Zuständige Behörden und deren Befugnisse.- 3.2.4 Pflichten für die Messgeräteverwender und Sanktionsmittel.- 4 Eichordnung.- 4.1 Anwenderpflichten.- 4.2 Anforderungen an die Eigenschaften einer Gerätebauart.- 4.2.1 Bauartzulassung.- 4.2.1.1 Allgemeine Anforderungen.- 4.2.1.2 Spezifische Anforderungen für Elektrizitätszähler und deren Zusatzeinrichtungen sowie Messwandler für Elektrizitätszähler.- 4.3 Anforderungen an die Geräteexemplare (Stück-Eigenschaften).- 4.3.1 Eichung.- 4.3.2 Gültigkeitsdauer der Eichung.- 4.3.3 Andere behördliche Messgeräteprüfungen: Befundprüfung/Sonderprüfung.- 4.3.4 Prüfstellenwesen.- 4.3.5 Ausnahmen von der Eichpflicht.- 5 Zusammenfassung — Ausblick.- Literatur.- Liberalisierungs- und Harmonisierungsansätze im Bereich des Messens der elektrischen Energie und Leistung.- 1 Einführung.- 2 Verbraucherpolitik.- 2.1 Instrumente der Verbraucherpolitik.- 2.2 Wahl der Instrumente für den Strommarkt.- 2.2.1 Das britische Beispiel der ECC.- 2.2.2 Das Beispiel des deutschen Telekommunikationsmarktes.- 3 Europäische Harmonisierung der Anforderungen an die Messtechnik.- 3.1 Betroffene Messgeräte für Elektrizität.- 3.2 Neue Verfahren der Konformitätsbewertung.- 3.3 Auswirkungen auf das gesetzliche Messwesen im Bereich der Elektrizitätsmessung.- Literatur.
Deregulierung, Wettbewerb, freier Netzzugang müssen seit Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts umgesetzt werden. Die Energieversorger müssen den Wettbewerb beginnen und dabei einen gewaltigen (informations-) technologischen Wandel vollziehen. Dazu sind u.a. neue Abrechnungssysteme einzuführen, die eine Schlüsselrolle in diesem Wandel spielen. Dieses Buch zeigt das Instrumentarium zur Vermarktung der Stromprodukte: Regeln des Marketings für die "Ware Strom", Einsatz moderner Meß- und Informationstechnik mit einem unternehmensübergreifenden Informationsmanagement vom Elektrizitätszähler bis zur Rechnungstellung, Selbstkontrolle auf Anbieterseite wie Verbändevereinbarung, Grid-Distribution-Metering Codes und Industrienormung, Vertretung von Nachfragerinteressen wie Verbrauchervereine, Rechtsnormen, wie das Energiewirtschafts-, Wettbewerbs- und Eichrecht.
1997-2026 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa