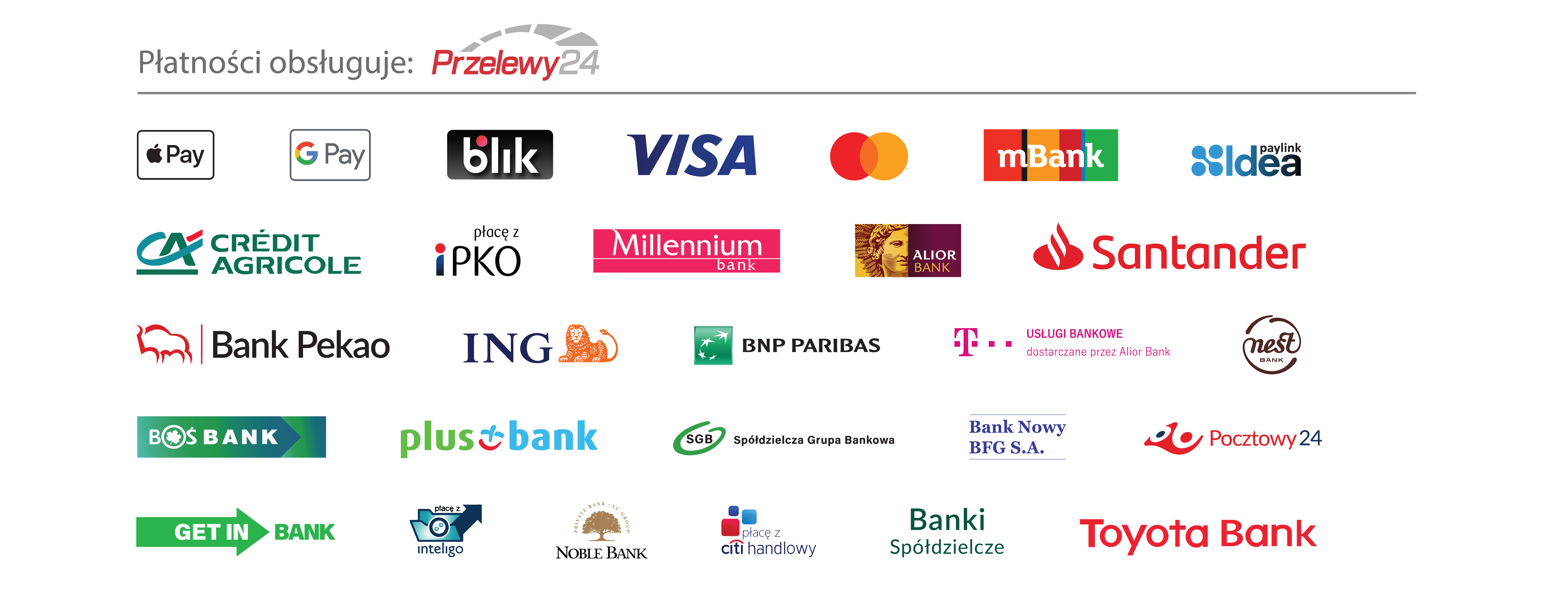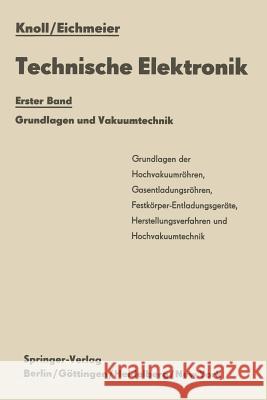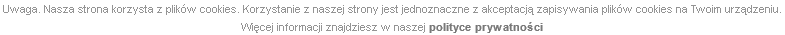Technische Elektronik: Erster Band Grundlagen Und Vakuumtechnik » książka


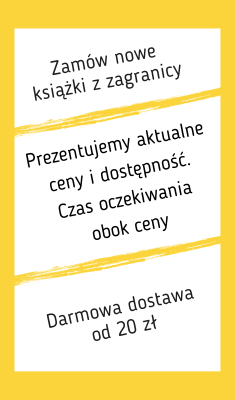
Technische Elektronik: Erster Band Grundlagen Und Vakuumtechnik
ISBN-13: 9783642929038 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 390 str.
Technische Elektronik: Erster Band Grundlagen Und Vakuumtechnik
ISBN-13: 9783642929038 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 390 str.
(netto: 178,70 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 180,14
ok. 22 dni roboczych
Dostawa w 2026 r.
Darmowa dostawa!
Einführung.- 1 Grundlagen der Entladungsgeräte.- I. Elementarteilchen und Atommodelle.- A. Typische Teilchendaten.- 1. Elektron.- 2. Ionen (z. B. H+-Ion, He+-Ion und Hg+-Ion).- 3. Strahlungsquanten (von Licht-, Röntgen-und radioaktiver Strahlung).- B. Teilchen- und Wellenbild.- 1. Beispiele zur experimentellen Bestimmung der Teilchen- bzw. Wellennatur der Elektronen.- a) Bestimmung der Elektronenladung e S..- b) Bestimmun gder Elektronenmasse m durch den Strahlungsdruck S..- c) Bestimmung des Verhältnisses e/m S..- d) Bestimmung der Elektronen-Wellenlänge durch Reflexion S..- 2. Mögliche Modell-Vorstellungen von Elektronen, Ionen und Atomen als Teilchen oder Welle.- C. Energiemodelle für Gase und Festkörper.- 1. Einzelheiten des Atombaus.- 2. Stoß Vorgänge.- a) Anregung und Ionisierung S..- b) Bestimmung der Ionisierungs- und Anregungsspannungen von Gasen durch Elektronenspektroskopie S..- 3. Termschemata.- a) Termschema der möglichen Energiezustände eines Gasatoms S..- b) Termschemata für den Kernzerfall S..- 4. Bändermodelle für Eestkörpergitter.- a) Metalle S..- b) Isolatoren S..- c) Eigen-Halbleiter S..- d) Störstellen-Halbleiter S..- D. Beschleunigung von Elementarteilchen im elektrischen Feld.- II. Thermische Elektronenquellen.- A. Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen bei der thermischen Emission.- 1. Energie-Struktur-Modelle für die Emission.- a) Bildkraft, Raumladung und Anodenfeld S..- b) Austrittsarbeit S..- 2. Maxwellsche Geschwindigkeits Verteilung.- 3. Fermi-Verteilung.- 4. Experimentelle Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen im Bremsfeld vor einer Glühkathode. Anlauf strom- Diodenkennlinie.- B. Emissionskonstanten für einige Kathodenstoffe.- C. Massiv-Kathoden.- 1. Energiebändermodell für emittierende reine Metalle.- 2. Konstruktionsdaten und Lebensdauer.- 3. Vereinfachtes Dimensionierungs verfahren für Wolfram-Massivkathoden.- a) Wahl von Kathodenmaterial und Betriebstemperatur S..- b) Bestimmung des Kathodendrahtdurchmessers d und des Heizstroms IH aus der gewählten spezifischen Heizfadenspannung UHG pro cm Kathodenlänge S..- c) Bestimmung von Heizspannung Ue und Emissionsstrom Is aus der gewählten Fadenlänge h S..- 4. Formierung von Wolfram-Massivkathoden.- 5. Warm-Zugfestigkeit Fw= f(T) von Wolfram-Massivkathoden.- D. Atomfilm-Kathoden.- 1. Strukturmodelle von Metallen mit Oberflächenschichten.- 2. Energiebändermodelle von Atomfilm-Kathoden.- 3. Thorium-Atomfilmkathoden.- E. Bariumoxyd-Kathoden.- 1. Strukturmodell und Emissionsvorgang für Bariumoxyd-Kathoden.- 2. Energiebändermodell der Bariumoxyd-Kathode.- 3. Konstruktion einfacher Oxyd-Kathoden.- 4. Vorratskathoden.- a) Die L-Kathode S..- b) Imprägnierte Kathode S..- c) Gepreßte Kathode S..- d) Matrix-Kathoden S..- III. Photo-, Sekundär- und Feldemissions-Elektronenquellen.- A. Photoelektronenquellen.- 1. Gesetzmäßigkeiten beim äußeren lichtelektrischen Effekt.- a) Ia—Ua-Kennlinien einer Photozelle S..- b) Einsteinsche Gleichung S..- c) Energieverteilung und Energiegrenzen der Photoelektronen S..- 2. Bändermodell für metallische Photokathoden.- 3. Elektronenausbeute und Lumen-Empfindlichkeit von Photokathoden.- 4. Quantenausbeute von Photokathoden.- 5. Spektrale Empfindlichkeitskurven typischer Photokathoden.- 6. Ermüdung von Photokathoden.- B. Sekundärelektronenquellen.- 1. Mechanismus der Sekundärelektronen-Emission.- 2. Sekundäremissionskurven.- 3. Theorien der Sekundäremission.- C. Feldemissions-Elektronenquellen.- IV. Kernstrahlungsquellen.- A. Gesetzmäßigkeiten und Einheiten.- B. ?-Strahler (Quellen doppelt positiv geladener He-Ionen).- 1. Eigenschaften.- 2. Ausführung typischer ?-Strahler.- C. ?-Strahler (Quellen schneller Elektronen).- 1. Eigenschaften.- 2. Ausführung typischer ?-Strahler.- D. ?-Strahler [Quellen energiereicher Strahlungsquanten (? ? 10?9 cm)].- 1. Eigenschaften.- 2. Ausführung typischer ?-Strahler.- a) Strahler niedriger Dosisleistung S..- b) Strahler hoher Dosisleistung S..- E. Positronenstrahler.- F. Neutronenstrahler.- 1. Eigenschaften.- 2. Ausführung typischer Neutronenstrahler.- a) Thermische Neutronenstrahler S..- b) Temporäre Neu-tronenstrahler aus Beryllium bzw. schwerem Eis S..- V. Technische Ionen- und Photonenquellen.- A. Technische Ionenquellen.- 1. Stoßionisations-Ionenquellen.- a) Kanalstrahlenquelle S..- b) Dampfstrahl-Ionenquelle S..- c) Quelle mit Elektronenpendelung im Gas S..- d) Glüh- kathoden-Gasentladungsquelle (Zyklotron-Ionenquelle nachLivingston) S..- 2. Thermische Ionenquellen.- B. Quellen für elektromagnetische Strahlung.- 1. Röntgenstrahlungsquellen.- 2. Leuchtschirme als Photonenquellen.- a) Mögliche Energie-Transformationen durch Leuchtschirme S..- b) Lichtquantenausbeute von Leuchtschirmen bei Elektronenbestrahlung S..- c) Energiebändermodell eines Luminophors S..- VI. Teilchenströme in Hochyakuum-Entladungsstrecken.- A. Stromwirkung des Einzelelektrons.- B. Teilchenströme im Hochvakuum bei schwacher Raumladung.- 1. Teilchenbahnen im homogenen elektrischen Feld.- a) Bahngleichungen S..- b) Relativistischer Fall S..- c) Anwendung der Elektronenstrahlablenkung im elektrischen Feld S..- 2. Teilchenbahnen im homogenen Magnetfeld.- a) Bahngleichungen S..- b) Relativistischer Fall S..- c) Anwendungen der magnetischen Ablenkung S..- 3. Teilchenbahnen im zusammengesetzten elektrischen und magnetischen Feld.- a) Allgemeine Bahngleichungen S..- b) Besondere Anwendungen S. 106..- C. Teilchenströme im Hochvakuum bei starker Raumladung.- 1. Raumladungsbegrenzung von Teilchenströmen.- 2. Der Raumladungs-Teilchenstrom in einer Diode mit ebenen Elektroden.- a) Teilchenstrom bei Vernachlässigung der Elektronen-Austritts- geschwindigkeit (v0 = 0) S..- b) Teilchenstrom bei Berück-sichtigung der Elektronen-Austrittsgeschwindigkeit (v0? 0; Geschwindigkeitsverteilung entsprechend dem Anlaufstromgesetz) S..- 3. Wirkungen der Raumladung in elektronenoptischen Entladungsgeräten.- VII. Grundlagen der geometrischen Elektronenoptik.- A. Vergleich der geometrischen Elektronenoptik mit der Lichtoptik.- B. Das elektronenoptische Brechungsgesetz.- 1. Elektronenstrahlbrechung im elektrischen Ablenkfeld.- 2. Elektronenstrahlbrechung an einer planparallelen elektrischen Doppelschicht (Feldschicht).- C. Elektronenoptische Abbildungsgesetze.- 1. Brennweitengleichung für eine sphärisch gekrümmte elektrische Doppelschicht.- 2. Abbildungsmaßstab für elektrische Linsen.- D. Typische elektrische und magnetische Elektronenlinsen.- 1. Elektrische Elektronenlinsen.- a) Netzlinsen (Doppelschichtlinien) S..- b) Lochscheibenlinsen S..- c) Rohrlinsen S. 128..- 2. Magnetische Elektronenlinsen.- E. Experimentelle Bestimmung von Feldern und Bahnen in der Elektronenoptik.- 1. Feldbestimmung.- a) Elektrische Felder S..- b) Magnetische Felder S. 135..- 2. Bahnbestimmung.- a) Graphische Bahnbestimmung S..- b) Experimentelle Bahn-bestimmung S..- VIII. Wirkungsweise stromsteuernder Hoch Vakuumröhren.- A. Hochvakuum-Mehrpolröhren.- 1. Hochvakuumdiode.- 2. Hochvakuumtriode.- a) Statische Kennliniengleichung S..- b) Dynamische Kennliniengleichung S..- c) Strom-, Spannungs- und Leistungs-verstärkung S..- 3. Tetrode (Röhre mit zwei Gittern).- 4. Pentode (Röhre mit drei Gittern).- 5. Hexode, Heptode, Oktode (Röhren mit 4, 5 und 6 Gittern).- B. Mikrowellenröhren.- 1. Laufzeittriode (500 bis 6000 MHz).- 2. Klystron (200 bis 50000 MHz).- a) Zwei- und Mehrkammer-Klystron S..- b) Reflexklystron S. 153..- 3. Das Magnetron (bis 30000 MHz).- 4. Die Wanderfeldröhre (bis 50000 MHz).- 5. Die Rückwärtswellenröhre („Carcinotron“; bis 100000 MHz).- IX. Teilchenströme in Gasentladungsstrecken.- A. Teilchenstrom bei Ionisierung durch Elektronenstoß.- 1. Townsendscher Ionisierungskoeffizient und spezifische Ionisierung.- 2. Stromverstärkung.- 3. Kontinuitätsbedingung für den Teilchenstrom.- B. Teilchenstrom bei Ionisierung durch Elektronen- und Ionenstoß.- 1. Stromverstärkung bei zusätzlicher Erzeugung von Ladungsträgern durch Ionenstöße im Gasraum.- 2. Stromverstärkung bei zusätzlicher Erzeugung von Ladungsträgern durch Ionenaufprall auf die Kathode.- 3. Zündbedingung und Paschensches Gesetz.- C. Allgemeine Gasentladungs-Charakteristik.- X. Teilchenströme in Halbleitern.- A. Leitfähigkeit von Halbleitern.- 1. Eigenleitung und Störstellenleitung.- a) Eigenleitung S..- b) Störstellenleitung S..- c) Quantitatives Ergebnis der Reinigung und Aktivierung von Germanium bzw. Silizium S. 177..- 2. Trägerbeweglichkeiten und spezifische Leitfähigkeit.- B. Verhalten von Halbleiter-Kontakten.- 1. Halbleiter-Metall-Kontakte.- a) Bedingungen für (ungetemperte) Ohmsche Kontakte S..- b) Bedingungen für (ungetemperte) Sperrschichtkontakte (Gleichrichter) S..- 2. p-n-Verbindungen.- a) Ohne äußeres Feld S..- b) Mit äußerem Feld („Kristalldiode“) S..- 3. p-n-p-Verbindungen („Transistoren“).- a) Aufbau und Wirkungsweise eines p-n-p-Transistors S..- b) Transistorschaltungen und -kennlinien S..- 4. Lichtempfindliche p-n-Verbindungen („Photoelement“).- 5. Vergleich zwischen Halbleiter- und Hochvakuum-Entladungsgeräten.- a) Dioden S..- b) Mehrpolgeräte S..- XI. Literaturverzeichnis zum Kapitel 1.- 2 Hochvakuumtechnik und Herstellungsprozesse der Entladungsgeräte.- I. Wechselwirkung von Teilchen mit Gasen und Dämpfen.- A. Ergebnisse der kinetischen Gastheorie.- 1. Atommasse und Atomgewicht (Eigenschaften des Einzelteilchens).- 2. Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung der Gasmoleküle (Eigenschaften des Teilchenkollektivs).- 3. Verhalten der Gase und Dämpfe (also des Teilchenkollektivs) 205 a) Boyle-Mariottesches Gesetz S..- b) Gay-Lussacsches Gesetz S..- c) Zustandsgieichung der idealen Gase S..- d) Daltonsches Gesetz (für Gemische von idealen Gasen) S..- e) Konzentration von Gasen und Dämpfen; Gesetz von Avogadro S. 209..- f) Volumen V einer Gasmenge vom Gewicht O S..- B. Auswahl der Gase und Dämpfe für Entladungsgeräte.- 1. Gasfüllungen zur Verdampfungserschwerung.- 2. Gasfüllungen zur Wärmeableitung.- 3. Gas- und Dampffüllungen zur Lichterzeugung.- a) Spektren (gleicher Gesamtintensität) von Hg bei verschiedenem Dampfdruck S..- b) Spektren von Argon bei verschiedenen Stromdichten (Betriebsspannungen) S..- c) Verschiedene Spektren von verschiedenen Zonen einer Glimmentladung S..- 4. Gasfüllungen zur Stromleitung.- C. Gewinnung und Reinigung der Füllgase für Entladungsgeräte.- 1. Edelgase.- a) Gewinnung S..- b) Reinigung S..- 2. Unedle Gase und Dämpfe.- a) Wasserstoffs..- b) Sauerstoff S..- c) Stickstoff S..- d) Dämpfe S..- D. Die mittlere freie Weglänge von Gasmolekülen, Elektronen und Ionen.- 1. Definition der mittleren freien Weglänge aus dem Gesetz der d) S..- d) Konturenschärfe von Metalldampfniederschlägen im Vakuum S..- e) Wahl der mittleren freien Weglänge bei Verdampfungsanlagen S. 237..- E. Dissoziation zweiatomiger zu einatomigen Gasen bei hohen Temperaturen.- II. Wechselwirkung von Elektronen mit Festkörpern 238.- A. Geschwindigkeitsstreuung und praktische Reichweite Re von Elektronen in „dicken“Folien bzw. Gasschichten (Gebiet der Vielfachstreuung; Foliendicke ?Re; 1? Aufzehrung von Gasen und Dämpfen durch gekühlte Oberflächen („kryogenes Pumpen“).- 2. Gasadsorption durch Kohle.- 3. Gasaufzehrung durch massive Metalle („Kontaktgetterung“).- a) Tantal (Ta) S..- b) Wolfram (W) und Molybdän (Mo) S..- c) Zirkonium (Zr) S..- d) Thorium (Th) und Uran (U) S..- e) Eisen (Fe) S..- f) Weitere Metalle S..- 4. Gasaufzehrung durch Metalldämpfe („Verdampfungsgetterung“).- a) Erwünschte Eigenschaften eines Verdampfungsgetters S..- b) Nachteile der Dampfgetter S..- 5. Gasaufzehrung durch Phosphor.- 6. Aufzehrung von Wasserdampf durch Trockenmittel.- IV. Vakuummeßtechnik und -meßgeräte.- A. Federmanometer.- 1. Prinzip.- 2. Meßbereich.- B. Flüssigkeitsmanometer (Barometer).- 1. U-Rohr-Manometer.- a) Prinzip S..- b) Meßbereich S..- 2. Ringwaage-Druckmesser.- a) Prinzip S..- b) Meßbereich S..- C. Molekulardruckmanometer.- 1. Prinzip.- 2. Meßbereich.- D. Reibungsmanometer.- 1. Prinzip.- 2. Meßbereich.- E. Kompressionsmanometer nach McLEod.- 1. Prinzip.- 2. Aufbau.- 3. Wirkungsweise.- a) Druckmessung bei veränderlichem Kompressionsvolumen S..- b) Druckmessung bei konstantem Kompressionsvolumen S..- 4. Meßbereich.- 5. „Klebevakuum“.- 6. Verkürztes Kompressionsmanometer.- 7. Vakuskop.- 8. Vor- und Nachteile des Kompressionsmanometers.- F. Wärmeleitungsmanometer.- 1. Prinzip.- 2. Ausführungsformen von Wärmeleitungsmanometern.- a) Widerstandsmanometer S..- b) Thermoelektrisches Manometer S..- 3. Anwendungen.- G. Ionisationsmanometer.- 1. Glühdraht-Ionisationsmanometer.- a) Triode mit negativem Gitter und Glühkathode S..- b) Bremsfeldtriode mit positivem Gitter und Glühkathode S..- c) Bayard-Alpert-Manometer S..- d) Nachteile der Glühdraht- Ionisationsmanometer S..- 2. Ionisationsmanometer mit kalter Kathode und Magnetfeld (Penning-Manometer).- a) Aufbau und Wirkungsweise S..- b) Meßbereich S..- c) Vor- und Nachteile S..- 3. Radium-Ionisationsmanometer (Alphatron).- a) Aufbau und Wirkungsweise S..- b) Meßbereich S..- c) Vor- und Nachteile S..- 4. Druckimpuls-Vakuummessung.- 5. Massenspektrographische Manometer.- a) Massenspektrograph-Manometer mit Magnetfeld S..- b) HF-Massenspektrograph-Manometer mit geradliniger Ionenbahn („Laufzeit-Spektrograph“) S..- c) HF-Massenspektrograph-Manometer mit spiralförmiger Ionenbahn („Omegatron“) S. 288..- H. Lecksuchgeräte.- 1. Druckanstiegsmessung beim Zuschalten einer Leckstelle.- 2. HF-Vakuumprüfer (Tesla-Prüfgerät).- 3. Abtasten mit einem Aroder He-Gasstrahl.- 4. Abtasten mit einem Ha-Strahl.- 5. Abtasten mit Trichloräthylen.- 6. Abtasten mit Dämpfen von Halogenverbindungen („Halogen-Lecksucher“).- 7. Differentielle Kondensationsmethode.- V. Vakuumpumpen.- A. Berechnung der Pumpvorgänge.- 1. Charakteristische Größen einer Vakuumpumpe.- a) Fördervolumen Fp bzw. Saugleistung S S..- b) Grenzdruck Pg S..- c) Zulässiger Außendruck p? S..- 2. Berechnung der Auspump- und Fördervolumen- Kennlinien.- a) Fp = Fpmax = const („Ideale Vakuumpumpe“) S..- b) Fp — F(p) (alle technischen Vakuumpumpen) S..- B. Ausführungsformen von rotierenden Vakuumpumpen.- 1. Vorvakuumpumpen.- a) Kolbenpumpe S..- b) Drehschieberpumpe S..- c) Drehkolbenpumpe (Schieber-Wälzpumpe) S..- 2. Fein- und Hochvakuumpumpen.- a) Rootspumpe (Zahnrad-Wälzpumpe) S..- b) Molekular-luftpumpen S..- 3. Leistungsbedarf rotierender Vakuumpumpen in Abhängigkeit vom Druck.- C. Treibmittelpumpen.- 1. Wasserstrahlpumpe (für Vorvakuum).- 2. Dampfstrahl- und Diffusionspumpen (für Hochvakuum).- a) Prinzip S..- b) Dimensionierung von Dampfstrahl- und ? 10-3 Torr; ?g ? 2R.- 2. Strömungswiderstand bei relativ niedrigen Drucken (p < ? 10?3 Torr;?g ? 2R).- a) Lange Vakuumleitungen (l?R; ?g?2R) S..- b) Öffnung in einer dünnen Wand (l?R; ?gR) S..- c) Kurze Vakuumleitungen (l?R; ?g>2R) S..- 3. Strömungswiderstand für lange Vakuumleitungen im gesamten Druckbereich (l?R;? g beliebig).- C. Berechnung von Vakuumanlagen.- 1. Fördervolumen in einem Vakuumleitungssystem mit angeschlossener Pumpe.- 2. Förderleistung in einem Vakuumleitungssystem mit angeschlossener Pumpe.- 3. Gütegrad einer Pumpanlage.- 4. Fördervolumen und Gütegrad von Vakuumanlagen im Gebiet der äußeren Eeibung (? g ?R; p < ? 10?3 Torr).- D. Auswahl der Vorpumpe für eine gewählte Hochvakuumpumpe.- VII. Typische Fertigungsverfahren für Elektronengeräte.- A. Vakuum-Elektronengeräte.- 1. Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe.- 2. Typische Fertigungsverfahren für Röhrenbauteile aus Metall.- a) Formgebung und Elektrodenaufbau S..- b) Verbindungen von Röhren-Metallteilen S..- c) Oberflächenbehandlung von Metallen S..- 3. Typische Fertigungs verfahren für Röhrenbauteile aus Glas.- a) Allgemeines S..- b) Formgebung von Glas S..- c) Oberflächenbehandlung S..- 4. Vakuumdichte Glas-Glas- und Glas-Metall-Verschmelzungen.- 5. Herstellung von Photokathoden.- a) Ag-Cs2O-Cs-Kathode (Oxydschicht-Photokathode) S..- b) SbCs3-Kathode (Metallverbindungs-Photokathode) S..- c) Sb-K-Na-Cs-Kathode (Mehrschicht-Photokathode; „Multialkali cathode“) S..- 6. Herstellung von Leuchtschirmen.- a) Perlverfahren S..- b) Sedimentationsverfahren S..- c) Auf dampf verfahren S..- d) Aufdruckverfahren S..- e) Aluminisierung von Leuchtschirmen S..- B. Festkörper-Elektronengeräte.- 1. Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe.- 2. Herstellung reiner Halbleiter.- a) Herstellung reiner Ge-Einkristalle S..- b) Herstellung reiner Si-Einkristalle S..- c) Herstellung von n- und p-Germanium bzw. n- und p-Silizium durch Dotierung (Aktivierung) S..- 3. Herstellung von Halbleiter-Metall-Kontakten.- a) Herstellung von Ohmschen (nichtgleichrichtenden) Kontakten S..- b) Herstellung von gleichrichtenden (Sperrschicht-)Kontakten S..- 4. Herstellung von (gewachsenen) p-n-Sperrschichten für Dioden.- a) Kristallziehung mit konstanter Geschwindigkeit S..- b) Kristallziehung mit periodisch veränderlicher Geschwindigkeit („rate grown“-Verfahren) S..- c) Epitaxial-Verfahren S..- 5. Herstellung von Transistoren.- a) Legierungs-Transistor S..- b) Gezogener Transistor S..- c) Diffusions-Transistor S..- d) Mesa-Transistor S..- e) Epitaxial-Transistor S..- f) Planar-Transistor S..- g) Epitaxial-Planar-Transistor S..- 6. Gehäuse für Dioden und Transistoren.- a) Klarglas-Gehäuse S..- b) Sinterglas-Gehäuse S..- c) Gehäuse mit Preßglasteller S..- d) Metall-Gehäuse mit Glaseinschmelzung S..- e) Kunststoff-Gehäuse S..- f) Gehäusefüllung S..- 7. Herstellung von mikroelektronischen Schaltungen.- a) Geätzte (gedruckte) Schaltungen S..- b) Mikromodul-Schaltungen S..- c) Integrierte Schaltungen S..- d) Halbleiter-Funktionsblöcke S..- VIII. Literaturverzeichnis zum Kapitel 2.
1997-2025 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa