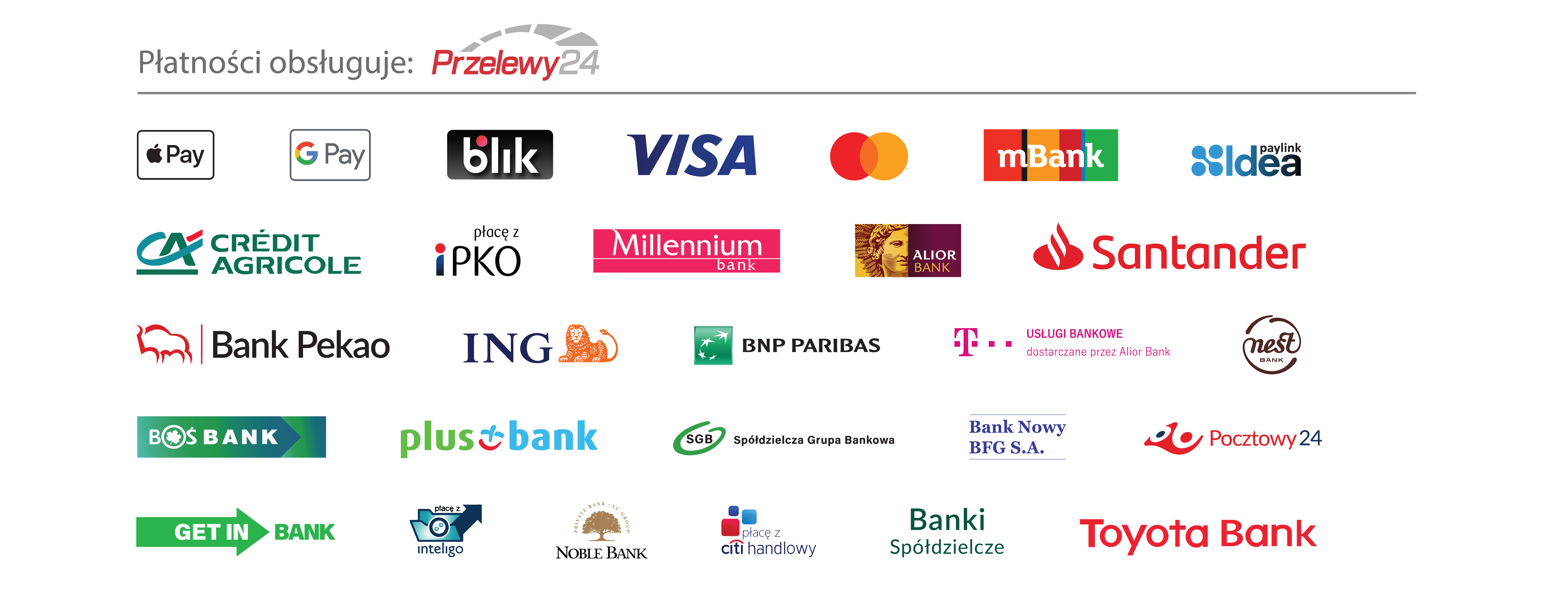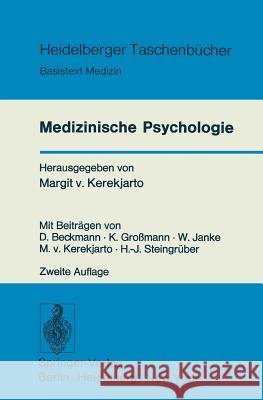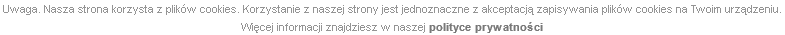Medizinische Psychologie: Basistext Medizin » książka


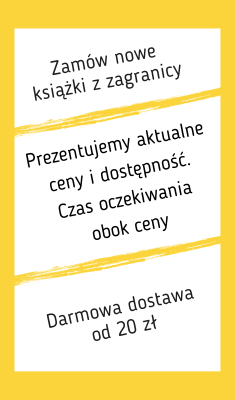
Medizinische Psychologie: Basistext Medizin
ISBN-13: 9783540075783 / Niemiecki / Miękka / 1976 / 308 str.
Medizinische Psychologie: Basistext Medizin
ISBN-13: 9783540075783 / Niemiecki / Miękka / 1976 / 308 str.
(netto: 197,03 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 198,14
ok. 16-18 dni roboczych.
Darmowa dostawa!
A. Psychophysiologische Grundlagen des Verhaltens.- I. Einleitung.- 1. Kennzeichnung "somatischer" und "psychischer" Prozesse.- 2. Aufgaben und Teilgebiete der physiologischen Psychologie.- 3. Physiologische Psychologie und Medizin.- II. Physiologische Methoden zur Untersuchung somatopsychischer Beziehungen.- 1. Verhaltensbedeutsame organismische Strukturen.- 2. Verhaltensbedeutsame organismische Variablen.- 2.1 Allgemeine Aspekte zur Auswahl von Variablen.- 2.2 Allgemeine Aspekte zur Auswertung physiologischer Variablen.- 2.2.1 Allgemeines.- 2.2.2 Die Bestimmung von Reaktionswerten.- 2.2.2.1 Das Gesetz der Ausgangslage.- 2.2.2.2 Arten von Reaktionsmaßen.- 2.2.3 Die Bestimmung von Ausgangslagenwerten.- 2.3 Maße des zentralen Nervensystems.- 2.3.1 Elektrische Erscheinungen an der Hirnoberfläche.- 2.3.1.1 Elektroencephalogramm (EEG).- 2.3.1.2 Evozierte Potentiale (EVP).- 2.3.1.3 Kontingente negative Variation (CNV).- 2.3.2 Elektrische Erscheinungen in subcorticalen Strukturen des Gehirns.- 2.4 Maße des muskulären Systems.- 2.4.1 Elektromyogramm.- 2.4.2 Mikrovibration.- 2.4.3 Tremor.- 2.5 Maße des vegetativen Nervensystems.- 2.5.1 Allgemeines.- 2.5.2 Kardiovasculäres System.- 2.5.2.1 Herzfrequenz.- 2.5.2.2 Blutdruck.- 2.5.3 Respiratorisches System.- 2.5.4 Temperaturregulation.- 2.5.5 Elektrische Erscheinungen der Haut.- 2.6 Biochemische Maße.- 2.6.1 Überblick über häufig verwendete Maße.- III. Ansätze zur Erfassung der Beziehungen zwischen Verhalten und physiologischen Prozessen.- 1. Überblick über Untersuchungsstrategien der physiologischen Psychologie.- 2. Umweltvariationen und Beobachtung korrespondierender Veränderungen somatischer und psychischer Prozesse.- 2.1 Allgemeines.- 2.2 Umweltveränderungen und Aktivation.- 2.2.1 Aktivation und Formatio reticularis.- 2.2.2 Aktivation und peripher-physiologische Veränderungen.- 2.2.3 Aktiviertheitsveränderungen und Art der Umweltvariation.- 2.2.3.1 Aktivation und betroffene psychische Funktion.- 2.2.3.2 Aktivation und Intensität der Stimuli.- 2.2.3.3 Aktivation und Dimensionalität der Stimuli.- 2.2.3.4 Informationsgehalt der Stimuli.- 2.2.3.5 Aktivation und zeitliche Charakteristik der Stimuli.- 2.2.3.6 Wirkungsrichtung der Stimuli.- 2.2.3.7 Motivational-emotionaler Bedeutungsgehalt der Stimuli.- 2.3 Umweltveränderungen und Streß.- 2.3.1 Definition von Streß.- 2.3.2 Klassifikation von Stressoren.- 2.3.3 Möglichkeiten und Problematik der Erfassung von Streßreaktionen.- 2.3.4 Streß und psychosomatische Störungen.- 3. Variationen des Verhaltens und Erlebens und Beobachtung von Veränderungen somatischer Prozesse.- 3.1 Allgemeines.- 3.2 Intensitätsvariationen von Verhalten und Erleben.- 3.2.1 Systematische Variationen im Experiment.- 3.2.2 Nicht-experimentelle Variationen.- 3.2.2.1 Allgemeines.- 3.2.2.2 Inneres Gleichgewicht (Homöostase).- 3.2.2.3 Schlaf und Traum.- 3.2.3 Probleme und begrenzende Faktoren bei der Untersuchung somatischer Prozesse in Abhängigkeit von der Intensität psychischer Prozesse.- 3.2.3.1 Intensitätsvariationen und Qualität psychischer Prozesse.- 3.2.3.2 Dissoziation physiologischer Variablen.- 3.3 Variation der Qualität psychischer Prozesse und somatische Veränderungen.- 3.3.1 Allgemeiner Untersuchungsansatz.- 3.3.2 Probleme der Differenzierung von Qualitäten psychischer Prozesse durch physiologische Variablen.- 3.3.2.1 Induktion von verschiedenen Qualitäten.- 3.3.2.2 Individualspezifität.- 4. Variation physiologischer Prozesse und Beobachtung von Verhaltensveränderungen.- 4.1 Allgemeines.- 4.2 Ausschaltung von Funktionen.- 4.2.1 Läsionen und Abtragungen.- 4.2.2 Chemische Blockierung und Hemmung.- 4.3 Anregung von Funktionen.- 4.3.1 Elektrische Stimulation.- 4.3.2 Chemische Stimulation.- IV. Physiologische Aspekte psychischer Prozesse.- 1. Motivation und Emotion.- 1.1 Allgemeines.- 1.1.1 Kennzeichnung motivationaler Prozesse.- 1.1.2 Kennzeichnung emotionaler Prozesse.- 1.1.3 Beziehungen zwischen motivationalen und emotionalen Prozessen.- 1.2 Physiologische Aspekte zur Differenzierung von Motivations- und Emotionsqualitäten und -Intensitäten.- 1.2.1 Allgemeines.- 1.2.2 Somatische Prozesse als Indikatoren motivationaler und emotionaler Intensitäten und Qualitäten.- 1.2.2.1 Motivationale und emotionale Intensitäten.- 1.2.2.2 Motivationale und emotionale Qualitäten.- 1.2.3 Somatische Prozesse als Bedingungsfaktoren für die Auslösung von Motivationen und Emotionen.- 1.2.3.1 Allgemeines.- 1.2.3.2 Variation peripher-physiologischer Prozesse.- 1.2.3.3 Variation zentralnervöser Prozesse.- 1.3 Motivation und Emotion als Resultat der Interaktion von somatischen und psychischen Faktoren mit der Umwelt.- 2. Wahrnehmung.- 3. Gedächtnis.- 3.1 Allgemeine Aspekte des Vergessens.- 3.2 Die Aufnahme von Informationen.- 3.3 Die Speicherung von Informationen.- 3.3.1 Kurzzeitgedächtnis.- 3.3.2 Stadium zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis (Zwischenzeitspeicher = ZZS).- 3.3.3 Langzeitspeicherung.- 3.3.3.1 Entwicklungsbiologische Aspekte des Langzeitgedächtnisses.- 3.3.3.2 Nucleinsäuren, Proteine und Gedächtnis.- 3.3.3.3 Langzeitgedächtnis und Synapsen.- 3.3.3.4 Langzeitgedächtnis und Lokalisation von Gedächtnisspuren.- 3.4 Abruf von Informationen (Retrieval).- 4. Denken und Intelligenz.- 4.1 Allgemeines.- 4.2 Funktioneller Ansatz.- 4.2.1 Physiologische Korrelate des Denkens.- 4.2.2 Veränderungen von Denkprozessen bei Variation physiologischer Prozesse.- 4.3 Anatomisch-lokalisatorischer Ansatz.- B. Entwicklung aus biologischer und sozialer Sicht.- 1. Psychologie und Entwicklungspsychologie.- 1.1 Die zeitliche Dimension.- 1.2 Definition.- 2. Biologische Grundlagen des Verhaltens.- 2.1 Das extrauterine Frühjahr.- 2.2 Die Gefahren der Geburt.- 2.3 Biologisch determinierte Tendenzen zur Brutpflege.- 2.4 Schlüsselreiz, AAM und Kindchenschema.- 2.5 Bindung und Prägung.- 2.6 Soziale Signale beim Aufbau von Wechselbeziehungen.- 2.7 Motivationskonflikte und Erlernen sozialer Signale.- 2.8 Paarbindung als Ergebnis einander widersprechender Motive.- 2.9 Gelingen und Mißlingen sozialer Interaktion.- 2.10 Motivationsanalyse und menschliche Sozialisation.- 2.11 Zusammenfassung.- 2.12 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mensch und Tier.- 3. Lernen.- 3.1 Anfänge der Lernpsychologie.- 3.2 Zwei Bedeutungen des Lernens.- 3.3 Evolution und Tradition.- 3.4 Lernen und Entwicklung.- 3.4.1 Der bedingte Reflex.- 3.4.2 Lernen am Erfolg und bedingte Aktion.- 3.4.3 Unterschied zwischen bedingter Reaktion und Lernenam Erfolg.- 3.4.4 Instrumentelles Lernen und bedingte Aktion.- 3.4.5 Schwächung (extinction).- 3.4.6 Unterschiedliche Verstärkungsfolgen.- 3.5 Der Aufbau von Bedeutungszusammenhängen.- 3.6 Lernen durch Beobachtung - Identifikation.- 3.7 Aggression und Konfliktbewältigung.- 3.7.1 Aggression nach Versagung.- 3.7.2 Aggression und Identifikation.- 3.7.3 Zweckgerichtete Aggression.- 4. Schwerpunkte der individuellen Entwicklung (Ontogenese).- 4.1 Stationen der Entwicklung in den beiden ersten Lebensjahren.- 4.1.1 Motorik und Sprache.- 4.1.2 Unterschiede im Verhalten.- 4.1.3 Unterschiede bei der sozialen Kontaktaufnahme.- 4.1.4 Frühe Wahrnehmungsfähigkeiten.- 4.1.5 Erlernen der Liebe.- 4.1.6 Mutter-Kind-Bindung.- 4.2 Das Vorschulalter.- 4.2.1 Die Bedeutung der Erfahrung im sozialen Rahmen.- 4.2.2 Kognitive Entwicklung.- Exkurs 1: Unbekanntheit des individuellen Erbguts.- Exkurs 2: Dynamische Hirnentwicklung.- 4.2.3 Sprache, Denken und Erfahrung.- 4.2.4 Schlußfolgerungen und Konsequenzen.- 4.2.5 Die Entwicklung der Persönlichkeit.- 4.2.5.1 Die Entstehung von Persönlichkeitseigenschaften.- 4.2.5.2 Gewissensbildung.- 4.2.5.3 Moralische Entwicklung.- 4.2.6 Selbstsicherheit und gesellschaftliche Normen.- 4.2.7 Spiel.- 4.2.7.1 Spielarten.- 4.2.7.2 Spieltherapie.- 4.2.8 Die Entwicklung der Geschlechtsrollen.- 4.2.8.1 Der lernpsychologische Erklärungsversuch für Geschlechtsrollenunterschiede.- 4.2.8.2 Das psychoanalytische Erklärungsmodell.- 4.2.8.3 Das kognitive Erklärungsmodell.- 4.2.8.4 Geschlechtsrolle und Erotisierung.- 4.3 Die Pubertät.- 4.3.1 Einige Konflikte und ihre möglichen Lösungen in der Pubertät.- 4.3.2 Die Acceleration.- 4.3.3 Persönlichkeitsverfall während der Pubertät?.- 4.3.4 Inadäquate Methoden zur Lösung pubertätsbedingter Konflikte.- 4.4 Das Erwachsenenalter.- 4.5 Schlußbemerkung.- C. Persönlichkeit: Methoden, Merkmale, Modelle.- 1. Einleitung.- 1.1 Idiographische und nomothetische Betrachtungsweise.- 1.2 Intra-versus interindividuelle Differenzen.- 1.3 Klinische versus statistische Vorhersage.- 1.4 Skalenqualität von Informationen.- 2. Methoden der Persönlichkeitserfassung.- 2.1 Beobachtung.- 2.1.1 Exploration, Interview, verbales Verhalten.- 2.1.2 Ausdrucksbeobachtung und -Beurteilung (Mimik, Gestik, Motorik).- 2.2 Testmethoden.- 2.2.1 Begriffsbestimmung.- 2.2.1.1 Korrelationskoeffizient.- 2.2.1.2 Gütekriterien eines Tests.- 2.2.1.3 Standardisierung von Tests, Stichprobenfehler, Normwerte.- Exkurs: Faktorenanalyse.- 2.2.2 Apparative Leistungstests.- 2.2.3 Kognitive Leistungstests.- 2.2.4 Fragebogen.- 2.2.4.1 Polaritätsprofil (semantic differential).- 2.2.5 Projektive Verfahren.- 3. Persönlichkeitsbereiche.- 3.1 Motivation.- 3.1.1 Der Motivationsbegriff als intervenierende Variable.- 3.1.2 Leistungsmotivation bzw. Leistungsstreben (need for achievement).- 3.1.3 Konflikt, Frustration, Abwehr.- 3.1.3.1 Konflikt.- 3.1.3.2 Frustration.- 3.1.3.3 Abwehrmechanismen.- 3.2 Wahrnehmung.- 3.2.1 Begriffsbestimmung.- 3.2.2 Wahrnehmungstheorien.- 3.2.3 Theorie der Feldabhängigkeit nach WITKIN (1954).- 3.2.4 Theorie des Adaptationsniveaus von HELSON (1947).- 3.2.5 Motivationale Wahrnehmungstheorien.- 3.2.6 Soziale Wahrnehmung (social perception).- 3.3 Intelligenz.- 3.4 Emotionen.- 3.4.1 Begriffsbestimmung.- 3.4.2 Angst.- 3.4.3 Aggression und Aggressivität.- 3.5 Extraversion und Introversion.- 3.5.1 Die Persönlichkeitstypen nach.- 3.5.2. Extraversion und Introversion als Konstrukte der empirischen Persönlichkeitsforschung.- 3.6 Geschlecht.- 4. Persönlichkeitsmodelle.- 4.1 Typologien.- 4.1.1 Begriffsbestimmung.- 4.1.2 Die Konstitutionslehre.- 4.2 Faktorenanalytisches Persönlichkeitsmodell.- 4.3 Die psychoanalytische Theorie.- D. Grundlagen psychischer Störungen.- 1. Definition psychischer Störungen.- 2. Erscheinungsformen psychischer Störungen.- 2.1 Kognitive Störungen.- 2.1.1 Gedächtnis.- 2.1.2 Denken.- 2.1.3 Wahrnehmung.- 2.2 Emotionale Störungen.- 2.2.1 Angst.- 2.2.2 Ärger/Aggressivität.- 3. Die Entstehungsbedingungen psychischer Störungen.- 3.1 Äußere (Umwelt-) Reize.- 3.1.1 Deprivationsexperimente.- 3.1.2 Trennung und Isolation in früher Kindheit.- 3.1.3 Familie und soziokulturelle Einflüsse.- 3.2 Innere (biochemische) Reize.- 3.3 Bedingungen der Reizverarbeitung.- 3.3.1 Psychische und physiologische Konstitution.- 3.3.2 Funktionsbeeinträchtigung des Zentralnervensystems.- E. Arzt-Patient-Beziehung.- 1. Übertragung.- 1.1 Dimensionen der Übertragung.- 1.2 Symptome und Übertragung.- 1.2.1 Organische Krankheiten.- 1.2.2 Psychosomatische Krankheiten.- 1.2.3 Funktionelle Syndrome.- 1.2.4 Konversionssymptome.- 1.2.5 Sucht.- 1.2.6 Psychotische Symptome.- 1.3 Übertragungsverschränkungen.- 2. Gegenübertragung.- 2.1 Dimensionen der Gegenübertragung.- 2.2 Kognitive Prozesse bei der Diagnosestellung.- 2.2.1 Wahrnehmungsfilter.- 2.2.2 Wahrnehmungskapazität.- 2.2.3 Gegenübertragungs-Agieren.- 2.3 Psychologische Diagnostik..- 3. Interaktion und Kommunikation.- 3.1 Interaktionsrituale.- 3.2 Interaktionsdimensionen.- 3.2.1 Metakommunikation.- 3.2.2 Doppelbindung.- 3.2.3 Schuld und Kausalität.- 3.3 Verringerung von Kontakt.- 4. Rollen von Patienten.- 4.1 Ohnmacht des Patienten.- 4.2 Typische Patientenrollen.- 4.2.1 Die Rolle des ängstlichen Abhängigen.- 4.2.2 Die Rolle des Organkranken.- 4.2.3 Die Rolle des Unmündigen.- 4.2.4 Die Rolle des Übergesunden.- 4.2.5 Die Rolle des Arztmeidenden.- 5. Rollen der Therapeuten.- 5.1 Allmacht des Arztes.- 5.2 Typische Arztrollen.- 5.2.1 Die Rolle des Überidentifizierten.- 5.2.2 Die Rolle des Organmediziners.- 5.2.3 Die Rolle des Sachlichen.- 5.2.4 Die Rolle des Helfenden.- 5.2.5 Die Rolle des Ambivalenten.- 6. Patientenselektion.- 6.1 Organmedizin.- 6.2 Psychologische Medizin.- 6.2.1 Indikation Psychotherapie.- 6.2.2 Andere Therapieformen.- 7. Funktionen der Diagnose.- 8. Norm und Sanktion.
1997-2026 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa