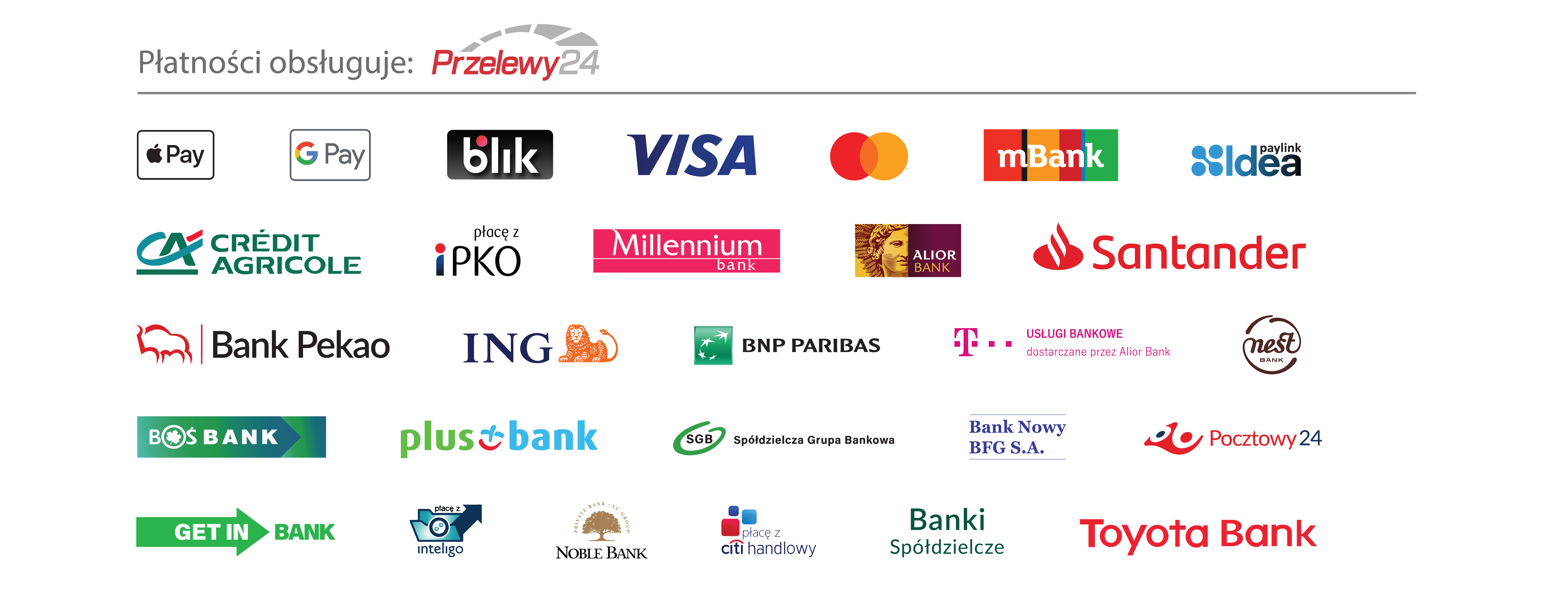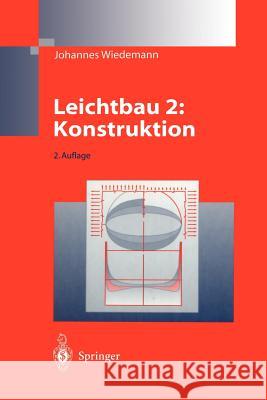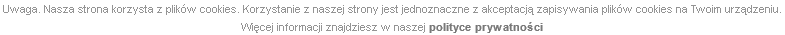Leichtbau: Band 2: Konstruktion » książka



Leichtbau: Band 2: Konstruktion
ISBN-13: 9783642646638 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 460 str.
Leichtbau: Band 2: Konstruktion
ISBN-13: 9783642646638 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 460 str.
(netto: 215,48 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 216,18
ok. 16-18 dni roboczych.
Darmowa dostawa!
Das zweibandige Werk Leichtbau ist das Standardwerk dieses Arbeitsgebietes fur Luft- und Raumfahrttechnik, Fahrzeugbau, Schiffs- und Meerestechnik, Maschinenbau, Fordertechnik, Stahlbau und Fertigungstechnik. Band 2 behandelt Kriterien und Verfahren des Entwerfens und Optimierens, der Auswahl und der beanspruchungsgerechten Gestaltung von Bauteilen und Strukturen auf der technologischen Basis aktueller Bauweisen und Werkstoffe, unter Gesichtspunkten der Zuverlassigkeit und der Schadenstoleranz. In der Neuauflage wurde die Weiterentwicklung der elektronischen Konstruktionssysteme sowie Erfahrungen aus der Konstruktionspraxis berucksichtigt."
"...Lehrbücher von hervorragender Qualität. Obwohl jeder Band als eigenständiges Werk konzipiert ist, ist es von Vorteil, den ersten Band ... vor dem zweiten ... durchzuarbeiten, um letzteren voll nutzen zu können... Die in den hervorragend ausgestatteten Bänden ausführlich behandelten Sachverhalte richten sich ... an Leichtbaukonstrukteure ... Das Werk ist ... nicht nur eine wertvolle Hilfe für ein einschlägiges Ingenieurstudium, es kann jedem Konstrukteur empfohlen werden." (Werkstatt und Betrieb)
1 Einführung.- 1.1 Fragen und Erwartungen an eine Konstruktionslehre.- 1.2 Das Problemfeld der Leichtbaukonstruktion.- 1.3 Zum Inhalt des Buches.- 2 Strukturentwurf.- 2.1 Zielmodell und Entscheidungsparameter.- 2.1.1 Kostenmodell.- 2.1.1.1 Kenngrößen des Entwurfs, Variationsebenen.- 2.1.1.2 Flächen-, Volumen- und Gewichtsfunktionen.- 2.1.1.3 Ansatz für ein Kostenmodell, Einfluß des Gewichtes.- 2.1.1.4 Gewichts-und Kostenmodell eines Fachwerks.- 2.1.1.5 Werkstoff- und Topologieentscheidung am Beispiel Fachwerk.- 2.1.2 Vergrößerungsfaktor der Zusatzgewichte.- 2.1.2.1 Eigenbelastete Strukturen, Gesamtgewicht über Nutzlast.- 2.1.2.2 Definition und Bestimmung des Vergrößerungsfaktors.- 2.1.2.3 Vergrößerungsfaktoren mehrstufiger Systeme.- 2.1.2.4 Der Vergrößerungsfaktor als Entscheidungsparameter.- 2.2 Beispiel Tragflügelstruktur Bauteilfunktionen.- 2.2.1 Resultierende Schnittlasten am schlanken Tragflügel.- 2.2.1.1 Lastvielfaches und Sicherheitsfaktor.- 2.2.1.2 Verteilung der Luft-und Massenkräfte am Tragflügel.- 2.2.1.3 Bestimmung der resultierenden Schnittlasten.- 2.2.2 Strukturkonzept des Biegetorsionsträgers.- 2.2.2.1 Elementare Kraftflüsse im Kastenquerschnitt.- 2.2.2.2 Wahl der Bauweise, Vordimensionierung der Kastenwände.- 2.2.2.3 Strukturkennwerte als Ähnlichkeitskennzahlen.- 2.2.3 Spezielle Funktionen einzelner Bauteile.- 2.2.3.1 Tragende Funktionen, Kraftwege im Explosionsbild.- 2.2.3.2 Funktionen der Kräfteeinteilung und der Kräfteumleitung.- 2.2.3.3 Stützende und stabilisierende Funktionen.- 3 Werkstoffe und Bauweisen.- 3.1 Metallische Werkstoffe.- 3.1.1 Spannungs-Dehnungs-Verhalten.- 3.1.1.1 Charakteristisches Werkstoffverhalten im Zugversuch.- 3.1.1.2 Elastisch-plastisches Verhalten von Aluminiumlegierungen.- 3.1.1.3 Elastisch-plastisches Verhalten anderer Metalle.- 3.1.1.4 Verhalten bei zweiachsiger Beanspruchung.- 3.1.2 Einflüsse der Plastizität auf das Bauteilverhalten.- 3.1.2.1 Plastische Biegung, bleibende Krümmung und Restspannungen.- 3.1.2.2 Plastischer Abbau von Kerbspannungsspitzen.- 3.1.2.3 Einfluß der Plastizität auf Knicken und Beulen.- 3.1.2.4 Plastische Arbeitsaufnahme bei Knautschelementen.- 3.1.3 Verhalten bei dynamischer und bei thermischer Beanspruchung.- 3.1.3.1 Wechsel-und Schwellfestigkeit über der Lastspielzahl.- 3.1.3.2 Statische und dynamische Warmfestigkeit.- 3.2 Verbundbauweisen.- 3.2.1 Faserkunststoffverbunde.- 3.2.1.1 Mechanische Eigenschaften der Fasern und der Matrix.- 3.2.1.2 Unidirektionale Faserlaminate.- 3.2.1.3 Steifigkeiten und Festigkeiten einiger Schichtlaminate.- 3.2.1.4 Viskoelastizität der Faserkunststoffe.- 3.2.1.5 Herstellung von Fasern und Faserlaminaten.- 3.2.2 Hybridbauweisen.- 3.2.2.1 Aufbau von Hybridlaminaten und Hybridverbunden.- 3.2.2.2 Tragverhalten unidirektionaler Hybridverbunde.- 3.2.2.3 Thermische Eigenspannungen und Verformungen.- 3.2.3 Sandwichbauweise.- 3.2.3.1 Aufbau und Herstellung des Sandwichverbundes.- 3.2.3.2 Besondere Festigkeits- und Konstruktionsprobleme.- 3.2.3.3 Vergleichende Beurteilung der Sandwichbauweise.- 3.3 Gewichtsbezogene Bewertungen.- 3.3.1 Gewichtsbezogene Materialkenngrößen.- 3.3.1.1 Festigkeiten.- 3.3.1.2 Steifigkeiten.- 3.3.1.3 Arbeitsaufnahme.- 3.3.2 Bewertung schichtspezifisch differenzierter Verbünde.- 3.3.2.1 Steife und feste Sandwichverbunde.- 3.3.2.2 Hybrid-Schichtverbunde hoher elastischer Arbeitsfähigkeit.- 3.3.3 Einfluß von Lastverhältnis, Geometrie und Strukturkenn wert.- 3.3.3.1 Festigkeitswertung bei Druckbehältern.- 3.3.3.2 Steifigkeitswertung bei gekrümmten Platten.- 3.3.3.3 Steiflgkeits-und Festigkeitswertung als Strukturproblem.- 4 Bauteiloptimierung über den Strukturkennwert.- 4.1 Der Strukturkenn wert und seine Funktionen.- 4.1.1 Definition des Strukturkennwertes.- 4.1.1.1 Punktbelastete Tragwerke.- 4.1.1.2 Linienbelastete Tragwerke.- 4.1.1.3 Flächenbelastete Tragwerke.- 4.1.1.4 Volumenbelastete Tragwerke.- 4.1.2 Funktionen des Strukturkennwertes.- 4.1.2.1 Gewöhnliche Kenn Wertfunktionen in Potenzform.- 4.1.2.2 Logarithmische Darstellung der Zielfunktionen.- 4.1.2.3 Abweichungen von der Potenzform.- 4.1.2.4 Materialwertung über den Strukturkennwert.- 4.2 Auslegung für Festigkeit und Steifigkeit.- 4.2.1 Festigkeitsauslegung von Zugträgern mit Anschlußelementen III.- 4.2.1.1 Zugseil oder Zugstab mit Anschlußknoten.- 4.2.1.2 Zugmembran oder Zugscheibe mit Anschlußnaht.- 4.2.1.3 Materialbewertung für Zugelemente.- 4.2.2 Auslegung von Balken-Biegeträgern.- 4.2.2.1 Balken mit rechteckigem Vollquerschnitt.- 4.2.2.2 Balken mit I-oder Kastenquerschnitt.- 4.2.2.3 Balken mit einfachsymmetrischem T-Querschnitt.- 4.2.2.4 Vergleich der Profiltypen über den Strukturkennwert.- 4.2.3 Auslegung von Platten-Biegeträgern.- 4.2.3.1 Platte mit homogenem Vollquerschnitt 125?.- 4.2.3.2 Integralplattenprofil mit einseitigen Längsstegen.- 4.2.3.3 Sandwichplatte mit schubstarrem Kern.- 4.2.3.4 Sandwichplatte mit schubweichem Kern.- 4.2.3.5 Vergleich der Plattenbauweisen über den Kennwert.- 4.2.3.6 Vorteile des Trägers gleicher Festigkeit.- 4.3 Auslegung gegen Knicken und Beulen :. r.- 4.3.1 Auslegung von Druckstäben.- 4.3.1.1 Druckstab mit rundem oder rechteckigem Vollquerschnitt.- 4.3.1.2 Druckstab mit Hohlquerschnitt.- 4.3.1.3 Druckstab mit Füllquerschnitt.- 4.3.1.4 Druckstab mit I-Profil.- 4.3.1.5 Vergleich der Bauweisen über den Stabkennwert.- 4.3.1.6 Druckstab mit längs veränderlichem Radius.- 4.3.2 Auslegung längsgedrückter Plattenstäbe.- 4.3.2.1 Platte mit homogenem Vollquerschnitt.- 4.3.2.2 Sandwichplatte mit schubstarrem Kern.- 4.3.2.3 Sandwichplattenstab mit schubweichem Kern.- 4.3.2.4 Integralplattenprofil mit einfachen Längsstegen.- 4.3.2.5 Plattenprofil mit geflanschten Stegen oder Stringern.- 4.3.2.6 Vergleich der Bauweisen über den Plattenstabkennwert.- 4.3.3 Auslegung längsgedrückter Plattenstreifen.- 4.3.3.1 Überkritische Auslegung isotroper Hautstreifen.- 4.3.3.2 Orthotroper Sandwichstreifen mit schubweichem Kern.- 4.3.3.3 Orthotroper Plattenstreifen mit Längsstegen.- 4.3.3.4 Orthotroper Plattenstreifen mit Kreuzverrippung.- 4.3.3.5 Plattenstreifen mit äquidistanten Einzelrippen.- 4.3.3.6 Vergleich der Bauweisen über den Plattenstreifenkennwert.- 4.3.4 Auslegung axial gedrückter Kreiszylinderschalen.- 4.3.4.1 Axialbelastete, unversteifte Schale mit Innendruck.- 4.3.4.2 Axial gedrückte Zylinderschale in Sandwichbauweise.- 4.3.4.3 Axial gedrückte Zylinderschale mit Waffelverrippung.- 4.3.4.4 Längsgestringerte Schale mit äquidistanten Einzelspanten.- 4.3.4.5 Vergleich der Bauweisen über den Zylinderkennwert.- 4.3.4.6 Zylinderbauweisen für Druckstäbe.- 4.3.5 Auslegung ebener Schub wände.- 4.3.5.1 Isotrope Schub wand, homogen oder in Sandwichbau weise.- 4.3.5.2 Schubwand mit äquidistanten Einzelrippen.- 4.3.5.3 Überkritische Schubwand, Zugfeld mit Pfosten.- 4.3.5.4 Orthotrope Schubwand, Einfluß der Steifenorientierung.- 4.3.5.5 Symmetrische Fachwerkschubwand.- 4.3.5.6 Unsymmetrische Fachwerkschubwand.- 4.3.5.7 Vergleich der Bauweisen über den Schubwandkennwert.- 4.3.6 Längsgestringerte Platte unter Druck- und Schubbelastung.- 4.3.6.1 Längsgestringerte Platte aus isotropem Material.- 4.3.6.2 Längsgestringerte, optimierte CFK-Platte.- 4.3.6.3 Bauweisen vergleich.- 4.4 Einfluß des Eigengewichtes auf die Konstruktion.- 4.4.1 Eigenlasteinfluß bei Zug- oder Biegebeanspruchung.- 4.4.1.1 Zugkonstruktion unter Nutz-und Eigenlast.- 4.4.1.2 Homogene Biegeplatte unter Nutz- und Eigenlast.- 4.4.1.3 Kastenträger vorgegebener Höhe, Eigenlasteinfluß.- 4.4.2 Einfluß des Eigengewichtes bei Knicken und Beulen.- 4.4.2.1 Knicken senkrechter Masten bei Eigenlast.- 4.4.2.2 Beulen senkrechter Rohrschalen bei Eigenlast.- 4.4.2.3 Versagen horizontaler Kastenträger bei Eigenlast.- 4.5 Optimierung im vielfach begrenzten Entwurfsraum.- 4.5.1 Tragwerke für Einzellastfall (single-purpose).- 4.5.1.1 Hohlstab unter Längsdruck.- 4.5.1.2 Füllstab unter Längsdruck.- 4.5.1.3 Sandwichplatte unter Querlastbiegung.- 4.5.1.4 Sandwichplatte unter Längsdruck.- 4.5.1.5 Längsversteifte Platte unter Querlastbiegung.- 4.5.1.6 Längsversteifte Platte unter Längsdruck.- 4.5.2 Tragwerke für mehrere Lastfälle (multi-purpose).- 4.5.2.1 Sandwichplatte unter Biegung oder/und Längsdruck.- 4.5.2.2 Sandwichplatte unter Schub oder/und Längsdruck.- 4.5.2.3 Orthotrope Platte unter Schub oder/und Längsdruck.- 4.5.2.4 Sandwichkessel unter Innendruck oder/und Längsdruck.- 4.5.2.5 Ortho troper Kessel unter Innendruck oder/und Längsdruck.- 4.5.2.6 Orthotrope Kastenwand unter Längszug oder Längsdruck.- 5 Entwurf und Optimierung von Kräftepfaden.- 5.1 Grundlegende Entwurfstheorie für Stab-und Netzwerke.- 5.1.1 Theoreme über optimale Dehnungsfelder.- 5.1.1.1 Satz von Maxwell.- 5.1.1.2 Satz von Michell.- 5.1.1.3 Konstruktion kontinuierlicher Michellsysteme.- 5.1.2 Beispiele zugbeanspruchter Optimalstrukturen.- 5.1.2.1 Alternative Stabwerke zu Punktlastgruppen.- 5.1.2.2 Alternative Strukturen für Zentrifugalkräfte.- 5.1.2.3 Netzflächenelement bei positivem Hauptlastverhältnis.- 5.1.2.4 Druckbehälter als Maxwellstruktur.- 5.1.3 Beispiele gemischt zug-und druckbeanspruchter Strukturen.- 5.1.3.1 Schubwand als Netz-oder Fachwerkstruktur.- 5.1.3.2 Symmetrische Lastgruppe, Zweistützenträger für Einzellast.- 5.1.3.3 Kragträger für Einzel- und Linienlast.- 5.2 Fachwerkentwurf durch Lineare Programmierung.- 5.2.1 Formulierung des LP-Problems, Leistung des Verfahrens.- 5.2.1.1 Vorgehensweise nach dem Michellprinzip.- 5.2.1.2 Annäherung eines Michellkragträgers.- 5.2.1.3 Einschränkung zulässiger Kräftepfade.- 5.2.1.4 Duale Formulierung des LP-Problems.- 5.2.1.5 Berücksichtigung des Stabknickens.- 5.2.2 Räumliche Fachwerke minimalen Volumens.- 5.2.2.1 Problemformat, Reduzierung des Rechenaufwandes.- 5.2.2.2 Möglichkeiten räumlicher Entwurfsrasterung.- 5.2.2.3 Mehrschichtiges Hallendach mit Kubusstruktur.- 5.2.2.4 Zweischichtiges Dach mit Oktaeder-Tetraeder-Struktur.- 5.2.2.5 Einschichtiges, tonnenförmiges Hallendach.- 5.2.2.6 Wert des Entwurfsverfahrens für die Konstruktion.- 5.2.3 Entwurfsoptimierung von Fachwerken nach Kostenkriterien.- 5.2.3.1 Definition der Kosten-Zielfunktion.- 5.2.3.2 Kostenminimaler Entwurf bei linearer Zielfunktion.- 5.2.3.3 Kostenminimale Entwürfe bei nichtlinearer Zielfunktion.- 5.3 Formentwicklung statisch bestimmter Fachwerke.- 5.3.1 Formulierung des Optimierungsproblems.- 5.3.1.1 Vorgaben und Variable der Formentwicklung.- 5.3.1.2 Restriktionen der Formentwicklung.- 5.3.1.3 Zielfunktion der Formentwicklung.- 5.3.2 Strategien der Formentwicklung.- 5.3.2.1 Direkte Suchverfahren.- 5.3.2.2 Evolutionsstrategische Verfahren.- 5.3.3 Ergebnisse reiner Formentwicklung ebener Fach werke.- 5.3.3.1 Einfluß des Stabknickproblems.- 5.3.3.2 Einfluß des Knotenaufwandes.- 5.3.3.3 Einfluß des Eigengewichts als Zusatzlast.- 5.3.3.4 Einfluß wechselnder Lastfälle (Mehrzweckstruktur).- 5.3.4 Formentwicklung mit Entwurfsoptimierung.- 5.3.4.1 Entwicklung nach alternativen Topologieentwürfen.- 5.3.4.2 Annäherung einer Michellstruktur.- 5.3.4.3 Topologievereinfachung durch zyklisches Verfahren.- 5.4 Optimierung statisch unbestimmter Fach-und Flächen werke.- 5.4.1 Optimaldimensionierung statisch unbestimmter Fachwerke.- 5.4.1.1 Dreistabsystem als Demonstrationsbeispiel.- 5.4.1.2 Entwicklung zu optimaler Kragträgertopologie.- 5.4.2 Isotropes Scheibenkontinuum.- 5.4.2.1 Dickendimensionierung nach der Spannungsgrenze.- 5.4.2.2 Entwurfsstrategische Auslegung der Scheibe.- 5.4.2.3 Dickenoptimierung über Funktionsansätze.- 5.4.2.4 Formoptimierung über Funktionsansätze.- 5.4.3 Faserschichtlaminat als orthotropes Kontinuum.- 5.4.3.1 Innendruckbehälter aus Glasfaserkunststoff.- 5.4.3.2 Schubwand aus Glasfaserkunststoff.- 6 Krafteinleitung, Ausschnitte und Verbindungen.- 6.1 Einleitung und Umleitung von Scheibenkräften durch Gurte.- 6.1.1 Gurtauslegung zur Längskrafteinleitung in Rechteckscheibe.- 6.1.1.1 Einfluß des Gurtes auf die Mittragende Scheibenbreite.- 6.1.1.2 Auslegung eines Einleitungsgurtes konstanter Spannung.- 6.1.1.3 Einfluß der Scheibenorthotropie auf die Gurtabnahme.- 6.1.1.4 Scheibe mit bereichsweise unterschiedlicher Steifigkeit.- 6.1.1.5 Besondere Maßnahmen zur Festigkeit.- 6.1.2 Scheibenausschnitte bei Randgurten, Neutralisierung.- 6.1.2.1 Elliptischer Ausschnitt mit konstant steifem Randgurt.- 6.1.2.2 Form- und Steifigkeitsgesetz des Neutralen Ausschnitts.- 6.1.2.3 Realisierung Neutraler Ausschnitte, Segmentbauweise.- 6.1.2.4 Quasi neutrale Konstruktionen für Rechteckausschnitte.- 6.2 Klebe Verbindungen zur Übertragung von Zug und Schub.- 6.2.1 Spannungsverteilungen nach elastischer Theorie.- 6.2.1.1 Analogie zum Sandwich-und zum Längsgurtmodell.- 6.2.1.2 Überlappungsverbindung zur Zugübertragung.- 6.2.1.3 Durchlaufende Scheibe mit Querstreifenpflaster.- 6.2.1.4 Überlappungen und Pflaster bei Schubübertragung.- 6.2.1.5 Schubspannungsspitzen bei Zug-und Schubübertragung.- 6.2.1.6 Schälspannungen in zugübertragenden Überlappungen.- 6.2.1.7 Einfluß der Blechbiegung auf die Kleberschubspannung.- 6.2.2 Auslegen and Gestalten von Klebeverbindungen, Tragfähigkeit.- 6.2.2.1 Verhalten, Modul und Festigkeit des Klebers.- 6.2.2.2 Elastizitätstheoretische Auslegung einfacher Überlappungen.- 6.2.2.3 Geschäftete oder mehrschichtig gestufte Verbindungslaschen.- 6.2.2.4 Tragfähigkeit nach Versuchen, Plastizitätseinfluß.- 6.2.3 Zeitverhalten überlappter Klebeverbindungen.- 6.2.3.1 Schwingfestigkeit der Klebeverbindung.- 6.2.3.2 Festigkeitsverlust durch Langzeitbelastung und Alterung.- 6.2.3.3 Kriechen der Klebeverbindung unter Langzeitbelastung.- 6.3 Niet- und Schraub Verbindungen.- 6.3.1 Statische Dimensionierung, Kräfteverteilung auf Nietreihen.- 6.3.1.1 Dimensionierung und Wirkungsgrad bei plastischem Ausgleich.- 6.3.1.2 Statisch unbestimmte Kraftverteilung auf Nietreihen.- 6.3.1.3 Maßnahmen zum Kräfteausgleich.- 6.3.2 Zugspannungsspitzen an Bohrungsrändern, Ermüdungsfestigkeit.- 6.3.2.1 Dimensionierungsaspekte bei elastischen Spannungsspitzen.- 6.3.2.2 Ermüdungsfestigkeit von Nietverbindungen.- 6.3.2.3 Vergleich zwischen Niet-, Punkt- und Klebeverbindungen.- 6.4 Flache Verstärkungen, Pflaster, Laschen und Winkel.- 6.4.1 Analyse und Auslegung flächenhafter Verstärkungen.- 6.4.1.1 Spannungsanalyse an elliptischen Verstärkungen ohne Loch.- 6.4.1.2 Kreissymmetrischer Lastfall, Neutralisierung des Loches.- 6.4.1.3 Lochverstärkungen für verschiedene Scheibenbelastungen.- 6.4.1.4 Versuchsergebnisse an GFK-Laminaten.- 6.4.2 Einfluß der Klebung bei Pflastern und Laschen.- 6.4.2.1 Verstärkendes Rundpflaster (Ring) um eine Bohrung.- 6.4.2.2 Deckendes Rundpflaster über einer Bohrung.- 6.4.2.3 Rechteckiges Pflaster über einem Riß.- 6.4.2.4 Rechteckige Lasche zur Kräfteeinleitung.- 6.4.3 Fügung profilierter Platten, Rippen- und Spantanschlüsse.- 6.4.3.1 Querstöße längsversteifter Platten.- 6.4.3.2 Anschluß von Rippen oder Spanten an gestringerte Flächen.- 7 Sicherheit und Zuverlässigkeit.- 7.1 Zuverlässigkeit bei Normalverteilungen.- 7.1.1 Zuverlässigkeit von Bauteilen und Tragsystemen.- 7.1.1.1 Häufigkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsintegral.- 7.1.1.2 Ermittlung einer Häufigkeitsverteilung.- 7.1.1.3 Zuverlässigkeit von Funktionsketten.- 7.1.1.4 Zuverlässigkeit von Funktionsgruppen (Parallelsystemen).- 7.1.2 Sicherheitsfaktor, Streufaktoren und Zuverlässigkeit.- 7.1.2.1 Sicherheit bei streuender Festigkeit und streuender Last.- 7.1.2.2 Optimierung der Sicherheitsfaktoren in Funktionsketten.- 7.2 Schwingfestigkeit und Lebensdauer.- 7.2.1 Schwingfestigkeit bei Einstufenbelastung.- 7.2.1.1 Kurzzeitfestigkeit, Zeitfestigkeit und Dauerfestigkeit.- 7.2.1.2 Kerbwirkung, Einfluß der Formzahl.- 7.2.1.3 Einfluß des Spannungsverhältnisses und der Mittelspannung.- 7.2.1.4 Streuung der Schwingfestigkeit.- 7.2.1.5 Ermüdung von Faserlaminaten.- 7.2.2 Schwingfestigkeit bei Betriebsbelastung.- 7.2.2.1 Zählverfahren zur Aufstellung von Lastkollektiven.- 7.2.2.2 Typische Formen des Lastkollektivs.- 7.2.2.3 Ergebnisse mehrstufiger Programm versuche.- 7.2.2.4 Hypothese der linearen Schadensakkumulation.- 7.3 Schadenstolerante und ausfallsichere Konstruktionen.- 7.3.1 Spannungsintensität und Rißfortschritt.- 7.3.1.1 Rißausbreitung unter zunehmender Last, Restfestigkeit.- 7.3.1.2 Rißfortschritt unter konstant schwingender Last.- 7.3.1.3 Rißfortschritt bei veränderlich schwingender Last.- 7.3.2 Behinderte Rißausbreitung, Maßnahmen und Wirkungen.- 7.3.2.1 Rißverzögerung durch Parallelelemente.- 7.3.2.2 Spannungsintensität des angerissenen Bleches mit Längssteifen.- 7.3.2.3 Restfestigkeit des angerissenen Bleches mit Längssteifen.- 7.3.2.4 Blechrißfortschritt und Stringerbruch bei schwingender Last-.- 7.3.3 Ausfallsichere unterteilte Konstruktion.- 7.3.3.1 Ausfallsicherheit einer Gruppe ausdimensionierter Elemente.- 7.3.3.2 Ausfallsicherheit eines nicht ausdimensionierten Stabwerks.- 7.3.3.3 Ausfallsicherheit eines Faser-Hybridverbundes.- 7.3.3.4 Ausfallsicherheit einer zweifach geschlossenen Torsionsröhre.- 7.3.3.5 Hilfsstrukturen zur Kräfteumleitung bei Teilausfallen.- Literatur.
Das zweibändige Werk Leichtbau ist das Standardwerk dieses Arbeitsgebietes für Luft- und Raumfahrttechnik, Fahrzeugbau, Schiffs- und Meerestechnik, Maschinenbau, Fördertechnik, Stahlbau und Fertigungstechnik. Band 2 behandelt Kriterien und Verfahren des Entwerfens und Optimierens, der Auswahl und der beanspruchungsgerechten Gestaltung von Bauteilen und Strukturen auf der technologischen Basis aktueller Bauweisen und Werkstoffe, unter Gesichtspunkten der Zuverlässigkeit und der Schadenstoleranz. In der Neuauflage wurde die Weiterentwicklung der elektronischen Konstruktionssysteme sowie Erfahrungen aus der Konstruktionspraxis berücksichtigt.
1997-2026 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa