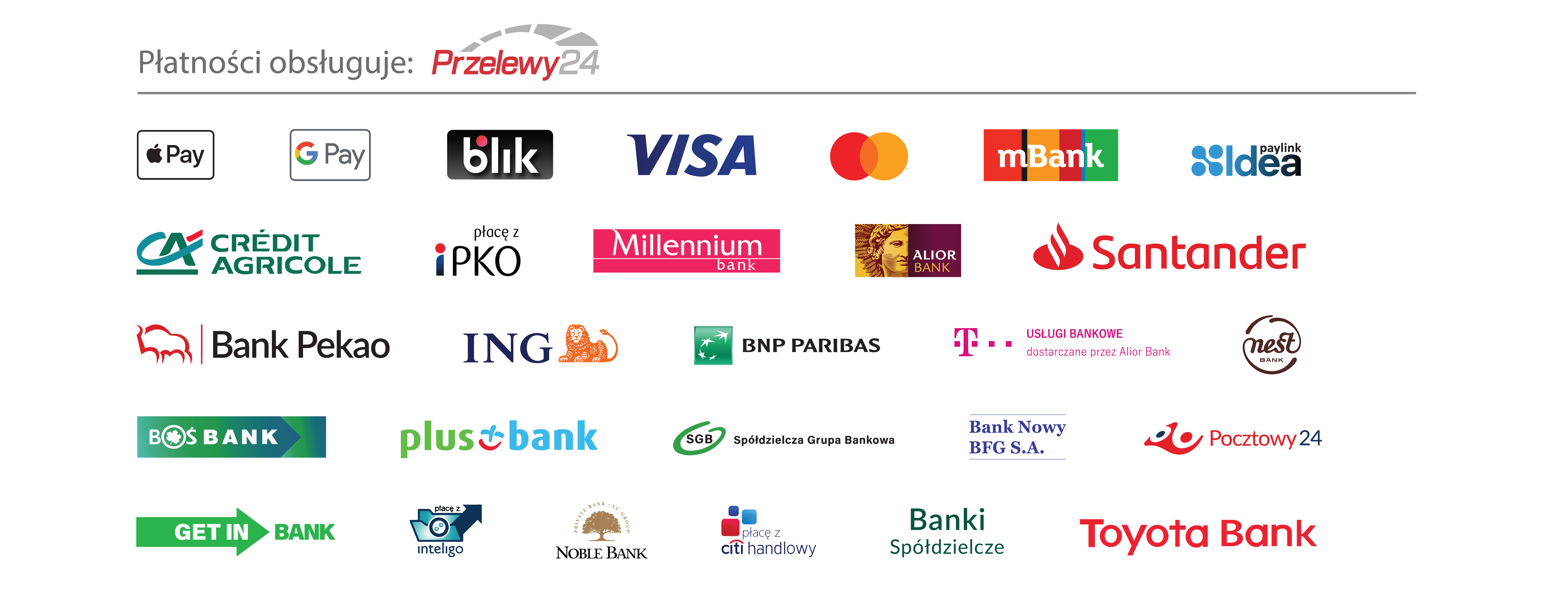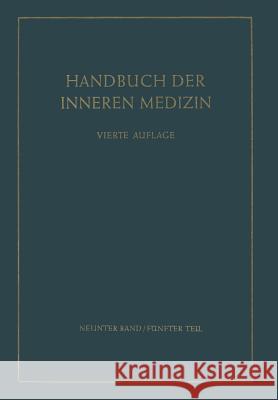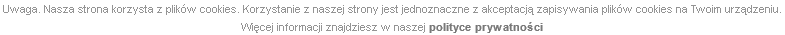Herz Und Kreislauf » książka


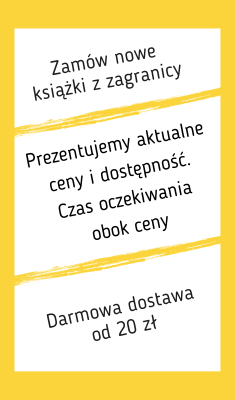
(netto: 197,03 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 198,14
ok. 22 dni roboczych
Dostawa w 2026 r.
Darmowa dostawa!
Fünfter Teil.- Hypertonie.- A. Der normale Blutdruck.- I. Die Blutdruckmessung.- II. Schwankungen des Blutdruckes unter physiologischen Bedingungen und die normale Variationsbreite.- 1. Alter und Geschlecht.- 2. Psychische Emotion.- 3. Muskelarbeit.- 4. Schlaf- und Tagesschwankungen.- 5. Körperhaltung.- 6. Konstitutionstypen.- 7. Rasse, Klima und Umgebungseinflüsse.- 8. Ernährung.- 9. Die Schwankungsbreite des normalen Blutdrucks.- III. Die Regulierung des Blutdruckes.- 1. Über die mechanischen Faktoren.- a) Der arterielle Windkessel.- b) Der elastische Widerstand.- c) Verteilerarterien.- 2. Die eigenreflektorische Steuerung des Blutdrucks.- 3. Die Presso- und Chemoreceptoren der Aorta, des Sinus caroticus und anderer Gefäßgebiete.- 4. Extravasale Reize in der Regulation des Kreislaufs.- a) Nutritive Reflexe (W. R. HESS).- b) Thermoregulatorische Einflüsse.- c) Reizung sensibler Nerven.- d) Corticale Einflüsse.- 5. Zentrale Steuerung des Kreislaufs.- 6. Hormonale und humorale kreislaufaktive Substanzen.- 7. Die Selbststeuerung des Kreislaufs als biologischer Reglermechanismus.- B. Klinische Einteilung der Hypertonie.- C. Die experimentelle Hypertonie.- I. Hochdruck durch Eingriffe an den Nieren.- 1. Reduktion von Nierengewebe.- a) Subtotale Nephrektomie.- b) Doppelseitige Nephrektomie.- c) Einseitige Nephrektomie.- 2. Einschränkung der Nierendurchblutung.- a) Einengung der Nierenarterien.- b) Kompression der Aorta.- c) Kompression der Nieren und Perinephritis.- d) Die Unterbindung der Ureteren.- e) Andere Eingriffe an den Nieren.- ?) Multiple Embolisierung der Nieren.- ?) Passive Hyperämie durch Einengung der Venen.- ?) Arteriovenöse Anastomosen der Nierengefäße.- ?) Röntgenbestrahlung der Niere.- f) Nephrotoxische Substanzen.- 3. Anatomische und funktionelle Folgen des experimentellen renalen Hochdrucks.- a) Pathologische Anatomie.- b) Funktionelle Folgen des experimentellen renalen Hochdrucks.- ?) Nieren.- ?) Hämodynamik.- ?) Wasserhaushalt und Mineralstoffwechsel.- ?) Vasomotorische Reaktionen.- ?) Blut.- 4. Pathogenese des experimentellen renalen Hochdrucks.- a) Diskussion des neurogenen Mechanismus.- b) Diskussion des Einflusses endokriner Organe.- ?) Nebennierenmark.- ?) Nebennierenrinde.- ?) Hypophyse.- Hypophysenvorderlappen.- Hypophysenhinterlappen.- c) Humorale Genese.- 5. Renin und Hypertensin.- a) Chemisch-physikalische Eigenschaften des Renins.- b) Wirkungsbedingungen des Renins auf den Blutdruck.- c) Hypertensinogen.- Hypertensinogengehalt des Plasmas unter experimentellen und pathologischen Bedingungen.- d) Hypertensin.- ?) Biologische Identifizierung und Wertbestimmung.- ?) Physikalisch-chemische Eigenschaften.- ?) Chemische Reaktionen.- e) Pharmakologische Wirkungen von Renin und Hypertensin.- ?) Wirkung auf die Nieren.- ?) Wirkung auf die Atmung.- ?) Wirkung auf andere Organe.- ?) Stoffwechselwirkungen.- ?) Wirkungen am Menschen.- f) Pepsitensin.- g) Hypertensinase.- Die Hypertensinase im Blut unter verschiedenen Bedingungen.- Andere Hypertensin zerstörende Fermente.- h) Antirenin.- i) Die Bedeutung des Renins und Hypertensins als humorale Faktoren in der Pathogenese des experimentellen renalen Hochdrucks.- II. Endokrin bedingter Hochdruck.- 1. Steroidhormone der Nebennierenrinde.- 2. Wirkungen auf den Mineralhaushalt.- 3. Experimenteller durch Verabreichung von Desoxycorticosteron hervorgerufener Hochdruck.- a) Pathologisch-anatomische Beobachtungen.- ?) Nieren.- ?) Gefäße.- ?) Herz.- ?) Gelenke.- b) Funktionelle Folgen der chronischen Verabreichung von DOCA.- c) Desoxycorticosteron-Hochdruck und Nierenfunktion.- ?) DOCA-Hochdruck und Mineralhaushalt.- ?) Metacorticoidaler Hochdruck.- d) Abhängigkeit des DOCA-Hochdrucks von anderen Hormonen und innersekretorischen Organen.- ?) DOCA und Nebennierenrindenhormone.- ?) DOCA und Nebennierenmarkhormon.- ?) DOCA und Schilddrüse.- ?) DOCA und Hypophyse.- e) Beeinflussung des DOCA-Hochdrucks durch andere Faktoren.- 4. Cortison und Blutdruck.- 5. Hydrocortison und Blutdruck.- 6. Aldosteron und Blutdruck.- 7. Nebennierenregenerationshochdruck.- 8. Androgene und Oestrogene.- 9. Wirkungen anderer Steroide (Vitamin D).- 10. Parathormon.- 11. Thymus.- 12. Hypophyse und Hochdruck.- 13. Experimenteller Hochdruck durch Cholinmangel.- III. Experimenteller neurogener Hochdruck.- 1. Entzügelungshochdruck durch Durchschneidung der regulierenden Nerven.- 2. Hochdruck durch Eingriffe am Zentralnervensystem.- IV. Psychosomatisch ausgelöster experimenteller Hochdruck.- V. Anhang: Spontane Hypertonie bei Versuchstieren.- D. Körpereigene vasoaktive Stoffe.- I. Pressorische Substanzen.- 1. Adrenalin und Noradrenalin (Arterenol).- a) Wirkungen von Adrenalin und Arterenol auf den Kreislauf.- b) Wirkung auf das Herz.- c) Wirkung auf die Nieren.- 2. Tyramin.- 3. Oxytyramin.- 4. Serotonin.- a) Darstellung und Reinigung.- b) Nachweis von Serotonin und Enteramin.- c) Pharmakologische Wirkungen.- 5. Pherentasin.- 6. Sustained pressor principle (Hochdruckstoff).- 7. Nephrin.- 8. Urohypertensin.- 9. Renin, Hypertensin.- 10. Pepsitensin.- 11. Flüchtige Basen mit nicotinähnlicher Wirkung.- 12. Guanidin.- 13. Vasoexcitor material (VEM).- II. Depressorische Substanzen.- 1. Histamin.- 2. Acetylcholin.- 3. Adenosin und seine Derivate.- 4. Vaso-Depressor-Material (VDM, Ferritin).- 5. Substanz P.- 6. Gehirnsubstanz von Major und Weber.- 7. Prostaglandin.- 8. Vesiglandin.- 9. Vagotonin.- 10. Angioxyl.- 11. Sog. 4. blutdrucksenkende Substanz aus Darm, Niere, Harn und Blut.- 12. Kallikrein.- a) Darstellung und chemische Eigenschaften.- b) Die Inaktivierung des Kallikreins.- c) Pharmakologische Wirkungen des Kallikreins.- ?) Kreislauf.- ?) Atmung.- ?) Glatte Muskulatur.- ?) Stoffwechsel.- d) Bildung und physiopathologische Bedeutung des Kallikreins.- e) Ornitho-Kallikrein.- 13. Kallidin.- 14. Depressan.- a) Chemische Eigenschaften.- b) Pharmakologische Eigenschaften.- c) Pathophysiologische Bedeutung.- d) Depressorische Stoffe aus der Niere.- E. Essentielle Hypertonie.- I. Definition und Klinik.- 1 Symptomatik.- 2. Diagnose.- 3. Die Gefäßreaktionen beim essentiellen Hochdruck.- 4. Die spontanen Blutdruckschwankungen.- 5. Pressorische Teste.- 6. Die pressorische Erregbarkeit der Gefäße bei anderen Hochdruckformen.- 7. Andere pressorische Teste.- 8. Depressorische Teste.- 9. Der Nitroglycerin-Flickertest.- 10. Sedationsteste.- 11. Häufigkeit der essentiellen Hypertonie.- 12. Endogene und exogene Faktoren.- II. Pathogenese.- 1. Heredität.- a) Einzelbeobachtungen an Familien und Gruppen.- b) Statistische Untersuchungen.- c) Zwillingsforschung.- 2. Kreislauffaktoren.- a) Untersuchungsmethoden.- b) Das Herzminutenvolumen bei essentieller Hypertonie.- c) Der periphere Widerstand.- d) Die Elastizität der Arterien.- e) Die aktive Blutmenge.- f) Extracellulärer Raum.- g) Viscosität.- h) Arterien, Capillaren, Venen.- i) Der Druck im Lungenkreislauf.- 3. Neurale Faktoren.- a) Vasomotorenzentrum.- b) Carotissinus.- 4. Renale Faktoren.- 5. Hormonale Faktoren.- a) Nebennierenmark.- b) Hypophysensystem — Nebennierenrinde.- ?) Elektrolyte.- ?) Corticosteroide.- 6. Andere humorale Faktoren.- 7. Psychische Faktoren.- a) Psychoanalytische Beobachtungen.- b) Psyche und Organfunktion.- c) Psychische Konstitutionstypen.- 8. Der klinische Beitrag zum Problem der Pathogenese.- 9. Kombination der essentiellen Hypertonie mit anderen Erkrankungen.- a) Fettsucht.- b) Diabetes mellitus.- c) Polycythämie und Polyglobulie.- d) Emphysem.- e) Stauungshochdruck.- f) Hypertonie bei Beinamputierten.- g) Hochdruck und Carcinom.- h) Verschiedene weitere klinische Faktoren.- i) Mitralstenose und Hochdruck.- k) Hypertonie im kleinen kreislauf.- 10. Zusammenfassende Betrachtung der Pathogenese der essentiellen Hypertonie.- III. Folgen und Komplikationen der essentiellen Hypertonie.- 1. Essentielle Hypertonie, anatomische Veränderungen der Gefäße und Arteriosklerose.- a) Die tierexperimentelle Arteriosklerose.- ?) Untersuchungen an Kaninchen.- ?) Untersuchungen an Hühnern.- ?) Untersuchungen am Hund.- b) Die menschliche Arteriosklerose.- 2. Folgezustände und Komplikationen der essentiellen Hypertonie an einzelnen Organen.- a) Herz.- ?) Herzhypertrophie.- ?) Coronardurchblutung und Coronarsklerose.- ?) Elektrokardiogramm.- ?) Herzinsuffizienz.- b) Cerebrale Komplikationen.- ?) Anatomische Befunde.- ?) Funktionelle Schwankungen der Hirndurchblutung beim Hypertoniker.- ?) Bedeutung der Capillarresistenz für die Entstehung apoplektischer Insulte.- ?) Augenhintergrundsveränderungen und cerebrale Gefäße.- c) Nierenfunktion.- ?) Nierenfunktionsproben.- Beziehung zwischen Herzminutenvolumen und Nierendurchblutung.- Größe der Nierendurchblutung und des Glomerulusfiltrates.- Die Filtrationsfraktion.- Die Phenolrotausscheidung.- ?) Pathologische Anatomie.- ?) Augenhintergrund.- ?) Retinaler Blutdruck.- IV. Prognose und Stadieneinteilung.- V. Therapie.- 1. Diätetik.- a) Die Reisdiät nach Kempner.- ?) Die Na-Beschränkung.- ?) Einfluß der salzfreien Kost auf Stickstoffgleichgewicht und Blutdruck.- ?) Mineralhaushalt.- ?) Fett und Cholesterin.- ?) Der Wirkungsmechanismus der natriumbeschränkten Kost und der Reisdiät.- b) Tierexperimentelle Untersuchungen der Diätbehandlung.- c) Hungerkuren.- d) Behandlung mit Kationenaustauschern.- e) Die Bedeutung der diätetischen Therapie für die Behandlung der essentiellen Hypertonie.- 2. Chirurgische Verfahren zur Behandlung der Hypertonie.- a) Wirkungen der Sympathektomie.- ?) Blutdruck.- ?) Orthostatische Regulationsstörungen.- ?) Andere hämodynamische Veränderungen.- ?) Elektrokardiogramm.- ?) Herzgröße.- ?) Augenhintergrundsveränderungen.- ?) Nierenfunktion.- ?) Beeinflussung der subjektiven Symptome.- ?) Lebensdauer und Mortalität.- ?) Postoperative Komplikationen.- b) Indikationen zur Sympathektomie.- c) Präoperative Teste.- d) Wahl der Operationsmethode.- e) Nebennierenresektion.- 3. Röntgentherapie.- 4. Medikamentöse Therapie.- a) Sedativa.- b) Antihistaminica.- c) Jod.- d) Magnesium.- e) Novocain.- f) Gefäßerweiternde Stoffe (Purinderivate, Spasmolytica u. a.).- g) Thiocyanate.- h) Fermente und fermenthemmende Stoffe.- ?) Aminooxydasen.- ?) Sulfhydrilverbindungen (Mercaptan).- i) Pyrogene Reaktionen.- k) Nierenextrakte und andere renal ausgeschiedene körpereigene Stoffe.- l) Vitamin A.- m) Pflanzenextrakte.- n) Hormonale Behandlung.- o) Heparin.- 5. Substanzen mit Wirkung auf das vegetative Nervensystem.- a) Cholin und Cholinderivate.- b) Sympathicolytica, Stoffe mit vorwiegend adrenergisch-blockierender Wirkung.- ?) Dihydroergotamin.- ?) Beta-Haloalkylamine (Dibenamin).- ?) Imidazole.- ö) Benzodioxanderivate.- 6. Rauwolfiaalkaloide.- a) Geschichte.- b) Chemie.- c) Pharmakologie.- Tierexperimentelle Erfahrungen.- Wirkungen auf das Nervensystem.- Blutdruck.- Toxicität und Nebenwirkungen.- d) Wirkungen am Menschen.- ?) Klinische Pharmakologie.- ?) Klinische Anwendung.- ?) Nebenwirkungen.- 7. Hydralazine.- a) Chemie.- b) Pharmakologie.- ?) Wirkungen im Tierexperiment.- ?) Toxische Wirkimgen.- c) Wirkungen am Menschen.- ?) Klinische Pharmakologie.- ?) Klinische Anwendung.- ?) Nebenwirkungen.- 8. Veratrumalkaloide.- a) Geschichte.- b) Vorkommen und Chemie.- c) Pharmakologie.- Tierexperimentelle Wirkungen.- d) Wirkungen am Menschen.- e) Klinische Anwendung.- f) Toxische Nebenwirkungen.- 9. Ganglienblocker.- a) Pharmakologie.- b) Wirkungen am Menschen.- ?) Hämodynamik.- ?) Nieren.- ?) Gehirn-durchblutung.- c) Klinische Anwendung.- ?) Hexamethoniumderivate.- ?) Pendiomid.- ?) Pentapyrrolidine.- ?) Chlorisondamin (Ecolid).- ?) N-methyl-camphidimum-di-Methylsulfat (Camphidoniuim).- ?) 3-Methyl-amino-iso-camphan-hydrochlorid (Mecamylamin).- 10. Die Kombination verschiedener Medikamente.- 11. Chlorothiazid und Hydrochlorothiazid.- 12. Bäderbehandlung.- 13. Psychotherapie.- 14. Indikation und Durchführung der Behandlung.- F. Renaler Hochdruck.- I. Durchblutungsstörungen.- 1. Arteriosklerotische und thrombotische Verschlüsse der Nierenarterien.- 2. Embolische Verschlüsse der Nierenarterien.- 3. Arteriovenöse Fisteln und Aneurysmen der Nierenarterien.- 4. Tumoren am Nierenstiel.- 5. Dystopie der Nieren.- 6. Perinephritis und Abflußstörungen der Niere.- 7. Nierentumoren.- 8. Cystenniere.- II. Entzündliche Nierenerkrankungen mit ungleichmäßigem Verlauf.- 1. Pyelonephritis.- 2. Nierentuberkulose.- III. Doppelseitige hämatogene diffuse Nierenerkrankungen.- 1. Akute diffuse und chronische Glomerulonephritis.- 2. Die extracapilläre diabetische Glomerulosklerose.- 3. Periarteriitis nodosa.- 4. Endangiitis obliterans.- 5. Maligner Hochdruck.- a) Krankheitsbild.- b) Pathologische Anatomie und Vorkommen.- c) Tierexperimentelle Erfahrungen zur Frage der Pathogenese.- d) Klinische Erfahrungen zur Pathogenese.- e) Klinische Definition, Diagnose und Verlauf.- IV. Therapie des renalen Hochdrucks.- 1. Operative Behandlung einseitiger Nierenerkrankungen.- 2. Konservative Behandlung des renalen Hochdrucks.- a) Durchblutungsstörungen.- b) Entzündliche Nierenerkrankungen mit ungleichmäßigem Verlauf.- c) Doppelseitige hämatogene diffuse Nierenerkrankimgen.- d) Maligner Hochdruck.- G. Hormonaler Hochdruck.- I. Phäochromocytom.- 1. Geschichtliches.- 2. Lokalisation.- 3. Histologie.- 4. Erkrankungsalter.- 5. Häufigkeit.- 6. Pathogenese.- 7. Beziehungen der Phäochromocytome zur Neurofibromatose Recklinghausen und anderen neurocutanen Erkrankungen.- 8. Symptome und Diagnose.- 9. Spezielle Symptomatik.- a) Blutdruck.- b) Herz.- c) Peripherer Kreislauf und Wärmeregulation.- d) Niere.- e) Augenhintergrund.- f) Cerebrale Symptome.- g) Hyperhidrosis, Tremor, Erbrechen.- h) Andere endokrin-vegetative Symptome.- i) Blut.- 10. Spezielle diagnostische Verfahren.- a) Bewertung der pharmakologischen Teste.- b) Druckprovozierende Teste.- ?) Der Kältetest.- ?) Der Histamintest.- ?) Der Mecholyltest.- ?) Der TEAB- oder Etamon-Test.- ?) Der DMPP-Test.- ?) Der Ephetonin-Test.- c) Drucksenkende Teste.- ?) Der Benzodioxan-Test.- ?) Der Regitintest.- ?) Der Dibenamin-Test.- d) Bestimmung der blutdruckaktiven Catecholamine im Harn.- e) Röntgendiagnostik.- ?) Verfahren mit Lufteinblasung.- ?) Kontrastdarstellung des Nierenbeckens.- ?) Kontrastfüllung der Nierenarterie oder Nierenvene.- f) Differentialdiagnose.- II. Therapie.- a) Konservative Behandlung.- b) Operative Behandlung.- c) Postoperative Kontrolle.- II. Syndrom von Cushing.- 1. Klinisches Bild.- 2. Pathologische Anatomie.- 3. Pathogenese.- 4. Klinische Symptomatologie und Laboratoriumsbefunde.- a) Morphologische Blutveränderungen.- b) Kohlenhydratstoffwechsel.- c) Plasmaelektrolyte.- d) ACTH.- e) Nebennierenrinden-Steroide.- 5. Zur Diagnose.- 6. Verlauf und Prognose.- 7. Behandlung des Cushing-Syndroms.- a) Behandlungsversuche der Hypophyse.- b) Operative Behandlungsversuche.- 8. Ähnliche Syndrome mit Blutdrucksteigerung bei Erkrankungen der Nebennieren und anderen endokrinen Funktionsstörungen.- a) Pseudo-Cushing.- b) Das adrenogenitale Hypertensionssyndrom.- c) Gemischte Nebennierenrindensyndrome.- d) Akromegalie mit Cushing-Syndrom.- e) Primärer und sekundärer Hyperaldosteronismus (Conus-Syndrom).- 9. Nebennierenrindensteroide und menschlicher Hochdruck.- a) DOGA.- b) ACTH und Cortison.- c) Aldosteron.- H. Neurogener Hochdruck.- I. Zur Bedeutung der Pressoreceptoren für den menschlichen Hochdruck.- 1. Funktionsprüfung des Carotissinus.- a) Carotissinus-Druckversuch.- b) Carotissinus-Anästhesie.- c) Okklusion der Carotiden.- 2. Entzügelungshochdruck beim Menschen.- 3. Hypertonie bei Poliomyelitis.- 4. Hochdruck bei Querschnittssyndrom.- II. Hochdruck zentral-nervöser Genese.- 1. Erhöhter Hirndruck.- 2. Vasopressorische Stoffe im Gehirn.- III. Therapie des neurogenen Hochdrucks.- J. Hochdruck bei Schwangerschaftstoxikosen.- I. Physiologische Veränderungen in der normalen Schwangerschaft des Menschen.- II. Hypertonie in der Schwangerschaft.- 1. Symptome.- a) Ödeme.- b) Proteinurie.- c) Krämpfe und Koma.- d) Nierenfunktion.- e) Durchblutungsstörungen anderer Organe.- 2. Pathologische Anatomie.- 3. Restschäden.- III. Pathogenese.- 1. Tierexperimentelle Untersuchungen.- a) Einfluß der Gravidität auf den tierexperimentellen Hochdruck.- b) Wirkungen renaler Ischämie bei schwangeren Tieren.- c) Experimentelle Erzeugung eklampsieähnlicher Syndrome.- 2. Die Spätschwangerschaftstoxikose des Menschen.- IV. Therapie der Schwangerschaftshypertonie.- 1. Anaesthetica und operative Eingriffe.- 2. Medikamentöse Behandlung.- a) Peripher angreifende, blutdrucksenkende Stoffe (Sympathicolytica und Ganglienblocker).- b) Substanzen mit komplexen Angriffspunkten.- ?) Hydralazine.- ?) Rauwolfiaalkaloide.- ?) Veratrumalkaloide.- K. Hochdruck durch Veränderungen der Kreislaufdynamik.- I. Aorten-Isthmusstenose (Coarctatio aortae).- 1. Entstehung und Vorkommen.- 2. Beschwerden und Diagnose.- 3. Prognose.- 4. Pathogenese der Blutdrucksteigerung.- a) Tierexperimentelle Befunde.- b) Untersuchungen am Menschen.- 5. Operative Behandlung der Isthmusstenose.- II. Sogenannte umgekehrte Isthmusstenose mit Hypertonie der unteren Körperhälfte (pulseless disease).- III. Hämodynamisch bedingter Hochdruck.- 1. Arteriosklerotische Hypertonie.- 2. Hypertonie bei Aorteninsuffizienz.- 3. Herzblock.- 4. Arteriovenöse Fistel.- 5. Blutdruck bei Thyreotoxikosen.- L. Hochdruck bei Vergiftungen.- I. Bleivergiftung.- II. Thalliumvergiftungen.- III. Kohlenoxydvergiftungen.- IV. Hochdruck nach Transfusionszwischenfällen, Sulfonamidunverträglichkeit und anderen toxisch-allergischen Schädigungen der Nieren.- Schluß.- Hypotonie.- A. Allgemeines.- I. Definition.- II. Häufigkeit.- III. Einteilung.- IV. Funktionsprüfungen.- 1. Sogenannte Herzfunktionsprüfung.- 2. Registrierung des Elektrokardiogramms im Stehen.- 3. Der Veritoltest.- 4. Röntgenuntersuchung des Herzens im Liegen und Stehen.- 5. Funktionsprüfung der Carotissinusreflexe.- 6. Bestimmung der Kreislaufzeit.- 7. Bestimmung der aktiven Blutmenge mittels Evansblue oder radioaktivem P32 oder Cr51.- 8. Prüfung des Wasserhaushaltes.- 9. Andere seltener notwendige Funktionsprüfungen.- B. Spezielle Krankheitsbilder.- I. Chronische Hypotonien.- 1. Konstitutionelle Hypotonie, essentielle Hypotonie bzw. hypotonischer Symptomenkomplex.- a) Subjektive Beschwerden.- b) Objektive Befunde.- c) Pathogenese.- ?) Endokrine Faktoren.- ?) Muskeltonus.- ?) Vererbung.- d) Diagnose.- e) Therapie.- 2. Symptomatische Hypotonien.- a) Bei organischen Erkrankungen des Herzens und der Gefäße. (Mitralstenose, Aortenstenose, Myokarditis, Perikarditis, allgemeine Arteriosklerose, Emphysem.).- b) Bei Lungenerkrankungen.- c) Bei endokrinen Erkrankungen.- ?) Morbus Addison.- ?) Hypophysäre Hypotonie (sekundäre Nebennierenrindeninsuffizienz).Addisonismus.- ?) Hypotonie bei Hypothyreose.- 3. Therapie.- II. Passagere Hypotonien.- 1. Bei Infektionskrankheiten.- 2. Postoperative Hypotonien.- 3. Bei Stoffwechselstörungen.- 4. Bei Vergiftungen.- 5. Orthostatische Reaktionen.- a) Das orthostatische Syndrom.- b) Der orthostatische Kollaps.- c) Postural hypotension.- 6. Das Carotissinussyndrom und andere reflektorische Blutdrucksenkungen.- 7. Emotionelle Hypotension (vasovagale Synkope).- 8. Therapie der passageren Hypotonien.- a) Physikalische Maßnahmen.- b) Sympathicomimetica.- c) Zentrale Analeptica.- d) Hormone der Nebennierenrinde.- e) Blutersatztherapie.- C. Schluß.- Literatur. Hypertonie.- Literatur. Hypotonie.
1997-2025 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa