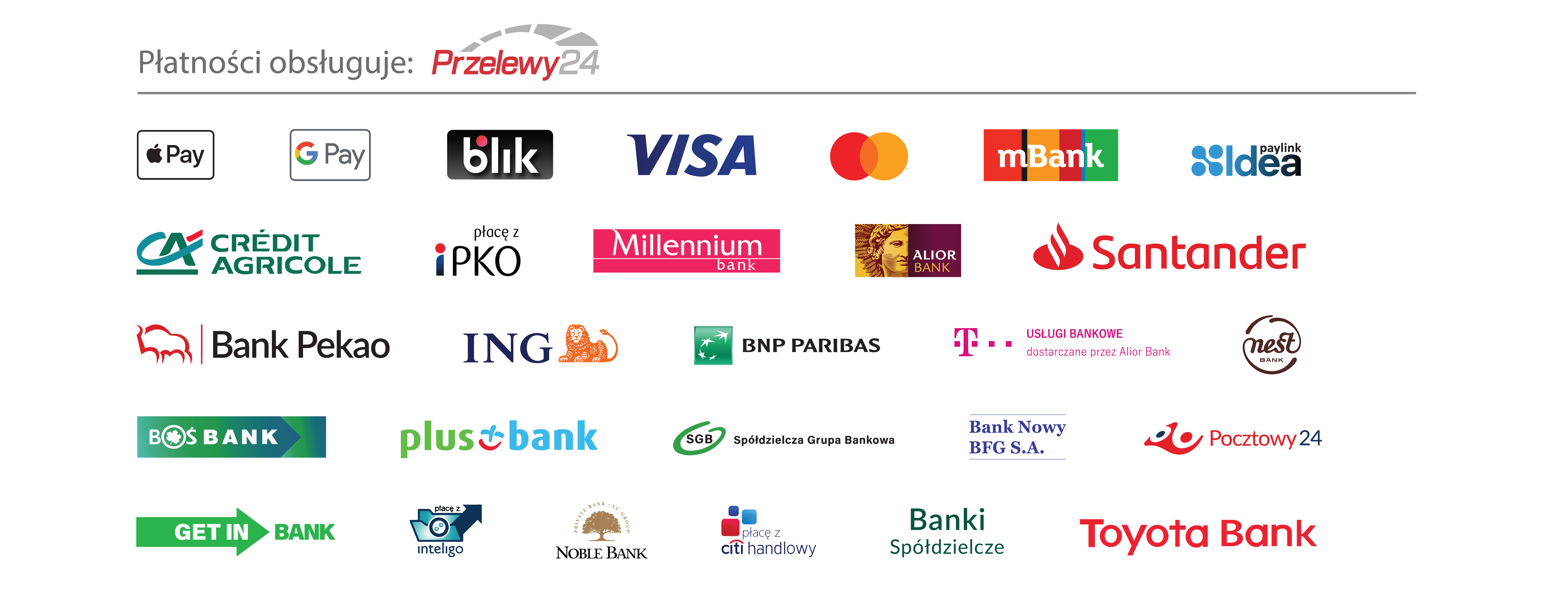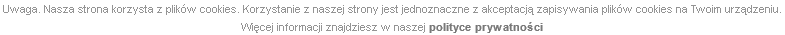Bedarfsgegenstände, Verpackung Reinigungs- Und Desinfektionsmittel » książka


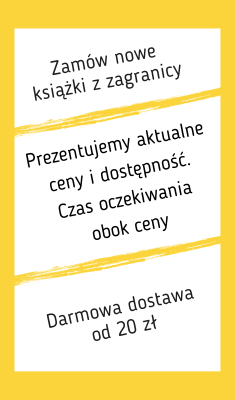
Bedarfsgegenstände, Verpackung Reinigungs- Und Desinfektionsmittel
ISBN-13: 9783642462283 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 988 str.
Bedarfsgegenstände, Verpackung Reinigungs- Und Desinfektionsmittel
ISBN-13: 9783642462283 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 988 str.
(netto: 286,63 VAT: 5%)
Najniższa cena z 30 dni: 288,25
ok. 22 dni roboczych
Dostawa w 2026 r.
Darmowa dostawa!
157 20 1 Westfiche Welt L 78 I 16 V 1 I 1 IJ I 1/ V 1/ Wesfeuropo V V V V 1/ ... ..v V 8R]} r- 17r- V' v L ... Y 2 t- I- ..... 1- f-I-- l-t-I--:: o 79';0 SZ S'I SG 58 GO &2 69 GG 68 70 Abb. 1. Welteneugung VOn Kunst8toffen Gesamtproduktion von 20,1 Millionen t. Die steile Aufwartsentwicklung der Kunststoffproduktion wird durch Abb. 1 veranschaulicht. Abb. 2 gibt einen Dberblick tiber den Anteil der drei groBen Kunststoffe Poly- vinylchlorid, Polystyrol und Polyolefine an der Gesamtproduktion der Kunst- 1970 Prognose t-Z8 (J Gesamt- produktion co. 23 Miot 7, SMiot 3Mio t 10,8 Mio t Abb. 2. Antell der drei glOBen Thermoplaste an der Kunststofferzeugung 158 G. TRIEM: Kunststoffe und andere Polymere fUr Bedarfsgegenstande stoffe von 1950 bis 1964 und gibt eine Schatzung uber ihren Anteil fUr das Jahr 1970. Genaue Zahlen uber den Anteil der produzierten Kunststoffmengen, der in den Lebensmittelsektor geht, liegen nicht vor und werden auch nur schwer und unvoll- kommen zu beschaffen sein. Man ist auf grobe Schatzungen angewiesen.
Bedarfsgegenstände aus Metall.- A. Allgemeines über das chemische Verhalten von Metallen gegen Lebensmittel.- I. Einleitung. Allgemeine Schadensarten und -ursachen.- II. Begriffs- und Maßnormen der Korrosion.- III. Korrosionstheorie.- IV. Korrosionsformen.- B. Beeinträchtigung der Lebensmittel durch die bei der Korrosion aufgenommenen Metallmengen.- C. Bedarfsgegenstände aus den einzelnen metallischen Werkstoffen.- I. Bedarfsgegenstände aus Aluminium und Aluminium-Legierungen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Chemisches Verhalten gegen Lebensmittel.- II. Bedarfsgegenstände aus Blei und Bleilegierungen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Chemisches Verhalten gegen Lebensmittel.- III. Verchromte Bedarfsgegenstände.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- IV. Bedarfsgegenstände aus Eisen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Chemisches Verhalten gegen einzelne Lebensmittel.- V. Bedarfsgegenstände aus nichtrostenden Eisenlegierungen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Chemisches Verhalten gegen einzelne Lebensmittel.- VI. Bedarfsgegenstände aus Kupfer und Kupferlegierungen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Chemisches Verhalten gegen einzelne Lebensmittel.- VII. Bedarfsgegenstände aus Nickel und Nickellegierungen.- 1. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 2. Chemisches Verhalten gegen einzelne Lebensmittel.- VIII. Silberne und versilberte Bedarfsgegenstände.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Chemisches Verhalten gegen einzelne Lebensmittel.- IX. Bedarfsgegenstände aus Zink und Zinklegierungen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Chemisches Verhalten gegen Lebensmittel.- X. Bedarfsgegenstände aus Zinn und Zinnlegierungen.- 1. Technologie und allgemeine Verwendung für Lebensmittel.- 2. Allgemeine Korrosionseigenschaften.- 3. Allgemeines zum praktischen Verhalten des Innern von Konservendosen.- 4. Verhalten gegen einzelne Lebensmittel.- D. Prüfung von metallischen Bedarfsartikeln auf Korrosionsbeständigkeit.- I. Korrosionsprüfung.- 1. Allgemeines.- 2. Arten der Korrosionsprüfung.- 3. Messung der Korrosion.- 4. Korrosionsprüfungen an Konservendosen.- II. Prüfung von Schutzüberzügen.- 1. Metallische Überzüge.- 2. Oxidische Überzüge.- 3. Lacküberzüge.- E. Bestimmung von Metallen in Lebensmitteln.- I. Bestimmung von Blei in fettarmen Lebensmitteln.- II. Polarographische Bestimmung von Zinn in Lebensmitteln.- III. Polarographische Bestimmung von Kupfer und Getränken.- F. Rechtliche Beurteilung von Bedarfsgegenständen aus Metall.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Deutsche Normblätter.- Metall-Beratungsstellen.- Bedarfsgegenstände aus keramischen Massen, Glas, Glasuren, Email.- I. Keramik.- 1. Geschichtliches.- 2. Wirtschaftliches.- 3. Keramische Massen.- a) Aufgliederung.- b) Grundbegriffe.- c) Bestandteile.- d) Glasuren.- 4. Definitionen.- a) Töpferwaren.- b) Fayence.- c) Majolika.- d) Steingut.- e) Steinzeug.- f) Porzellan.- 5. Technologie der Porzellanherstellung.- a) Herstellung der Massen.- b) Formgebung.- c) Trocknen.- d) Brennen.- e) Glasieren.- f) Dekor.- g) Technik der Dekorierung.- II. Email.- 1. Geschichtliches.- 2. Wirtschaftliches.- 3. Definition.- 4. Technologie der Emailherstellung.- a) Vorbehandlung der Bleche.- b) Grundemaillierung.- c) Deckemaillierung.- d) Spezialemaille.- III. Glas.- 1. Geschichtliches.- 2. Wirtschaftliches.- 3. Definition.- 4. Eigenschaften.- a) Physikalische Eigenschaften.- b) Mechanische Eigenschaften.- c) Chemische Eigenschaften.- 5. Technologie der Herstellung.- a) Rohstoffe.- b) Schmelze.- c) Läuterung.- d) Verarbeitung.- e) Kühlung.- f) Veredlung.- g) Spezialgläser.- IV. Glasfaser.- 1. Geschichtliches.- 2. Wirtschaftliches.- 3. Eigenschaften.- 4. Technologie der Herstellung.- 5. Glasfaser-Optik.- V Analytik.- 1. Herstellung des Essigsäureauszuges.- 2. Bestimmungsmethoden.- a) Blei.- b) Andere Metalle.- c) Borsäure.- 3. Beständigkeit von Glasuren und Dekor.- VI. Beurteilung.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Kunststoffe und andere Polymere für Bedarfsgegenstände.- A. Zur Anwendung der Kunststoffe.- 1. Einleitung.- 2. Technische Notwendigkeit der Verwendung von Kunststoffen bei der Herstellung von Bedarfsgegenständen.- 3. Sorgfaltspflicht der Hersteller und Anwender von Bedarfsgegenständen aus Kunststoffen.- 4. Lebensmittelgesetzliche Bestimmungen.- B. Kunststoffe und andere Polymere.- 1. Einteilung.- 2. Reaktionstypen für die Herstellung linearer Polymere.- a) Polykondensation.- b) Polyaddition.- c) Polymerisation.- d) Ionenkettenpolymerisation.- e) Misch- und Blockpolymerisate, Copolymerisate, Propfpolymerisate.- 3. Polymerisationsmethoden.- a) Substanzpolymerisation.- b) Lösungspolymerisation.- c) Suspensionspolymerisation.- d) Emulsionspolymerisation.- 4. Zusatzstoffe.- a) Wärme- und Oxydations-Stabilisatoren.- b) Optische Aufheller.- c) Gleit- und Formtrennmittel.- d) Antistatika.- e) Emulgatoren.- f) Schutzkolloide.- g) Fungicide.- h) Füllstoffe.- i) Blähmittel.- C. Wichtigste Hochpolymere.- 1. Polyäthylen (PE).- a) Hochdruckpolyäthylen.- b) Niederdruckpolyäthylen.- c) Phillips-Verfahren.- 2. Polypropylen (PP).- 3. Polyisobutylen (PIB).- 4. Polyvinylchlorid (PVC).- a) Emulsionspolymerisation.- b) Suspensions-Polymerisation.- c) Substanzpolymerisation.- d) Hilfsstoffe.- e) Stabilisatoren.- f) Gleitmittel.- g) Mischpolymerisate.- h) Mischungen.- i) Beständigkeit.- 5. Polyvinylidenchlorid (PVDC).- 6. Polytetrafluoräthylen (PTFE).- 7. Polyvinyläther.- a) Eigenschaften.- 8. Polyacrylsäure- und Polymethacrylsäureester.- a) Emulsionspolymerisate.- 9. Mischpolymerisate aus Äthylen, Vinylestern und ungesättigten aliphatischen Säuren, deren Salzen und deren Estern.- 10. Polystyrol (PS).- a) Mischpolymerisation.- 11. Polyamide (PA).- 12. Polyacetale (POM).- 13. Polycarbonate (PC).- 14. Polyterephthalsäureäthandiolester.- 15. Ungesättigte Polyesterharze (UP).- 16. Vernetzte Polyurethane.- a) Vernetzte Polyurethane als Klebschichten.- 17. Cellulose-Derivate.- a) Zellglas.- b) Celluloseacetat und -propionat.- 18. Aminoplaste.- 19. Silicone.- 20. Natur- und Synthesekautschuk.- Vulkanisation und Vernetzung.- Alterungsschutzmittel.- Weitere Hilfsmittel.- Weichmacher.- Treibmittel.- Farbstoffe.- Verwendung.- a) Verarbeitung von Gummi.- D. Verformung der Kunststoffe zu Bedarfsgegenständen.- 1. Verarbeitung der Thermoplaste.- a) Extrusion.- b) Kalandrieren.- c) Spritzguß.- d) Beschichtung von Papier mit Folien aus thermoplastischen Kunststoffen.- e) Papierbeschichtung mit Hilfe von Dispersionen.- f) Vakuum-Tiefziehen.- 2. Duroplastverarbeitung.- a) Ungesättigte Polyesterharze.- b) Andere Duroplaste.- 3. Weitere Verarbeitungsmethoden.- a) Kunststoffschäume.- b) Blasfolien aus geschäumtem Polystyrol.- c) Schweißen.- d) Verarbeitung von Abfällen.- e) Bedrucken.- E. Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes im Lichte des Gesetzes über den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen.- 1. Allgemeines.- 2. Zur rechtlichen Bedeutung der Empfehlungen.- 3. Antragsverfahren.- 4. Ergänzende Notizen zu den Empfehlungen.- F. Prüfung von Kunststoffen.- 1. Bestimmung der Kunststoffe.- a) Vorproben.- b) Bestimmung der Heterolelemente.- c) Lösungsmittel für Kunststoffe.- d) Pyrolyse.- e) Infrarotspektroskopie.- f) Brechungsindex.- 2. Definierter chemischer Abbau von Kunststoffen.- a) Polyester.- b) Ungesättigte Polyester.- c) Polyäther.- d) Melamin und Harnstoff-Formaldehydharze.- e) Polyamide.- 3. Schmelzindex.- a) Erweichungsbereich.- b) Kristallitschmelzpunkt.- 4. Dichte.- 5. Zusammenfassung.- 6. Bestimmung der Extrahierbarkeit von Kunststoffen.- a) Extraktion von beschichtetem Material.- b) Prüfung auf Überwanderung von Fremdstoffen auf Lebensmittel (Migration).- c) Extraktion mit Fett.- d) Nachweis von Weichmachern in Fetten.- e) Übergang von Gleitmitteln aus Polystyrol auf Kokosfett.- f) Weitere Prüfungen.- 7. Untersuchung von Bedarfsgegenständen gemäß den Mitteilungen des Bundesgesundheitsamtes.- a) Prüfung auf Farblässigkeit bei in der Masse gefärbten Kunststoffen.- b) Prüfung von bunten Kinderspielwaren auf Speichel- und Schweißechtheit.- c) Bestimmung von Formaldehyd.- 8. Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Gummi.- a) Qualitative Bestimmung der Kautschuksorten.- b) Prüfung der Bedarfsgegenstände auf extrahierbare Bestandteile.- c) Bestimmung von Aminen.- d) Bestimmung von Zink und Blei.- 9. Bestimmung der leichtflüchtigen organischen Bestandteile in Bedarfsgegenständen.- a) Vorbereitung der Proben.- b) Ausführung.- c) Berechnung.- d) Bestimmung von monomerem Acrylnitril in Polymerisaten.- 10. Prüfung von Trinkwasserleitungsrohren aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, weichmacherfreien Vinylchlorid-Mischpolymerisaten und -Polymerisatgemischen.- 11. Prüfung der geschmacklichen und geruchlichen Beeinflussung von Lebensmitteln durch Bedarfsgegenstände.- 12. Prüfung auf Peroxydsauerstoff.- 13. Zusammenfassung und Ausblick.- G. Beispiele für die Anwendung von Bedarfsgegenständen aus Kunststoffen.- 1. Molkereiprodukte.- a) Butter.- b) Milch (allgemeine Gesichtspunkte).- c) Speisequark.- d) Käse.- e) Joghurt.- 2. Margarine.- 3. Speiseöl.- H. Allgemeine Hinweise für die Anwendungsmöglichkeiten von Packstoffen.- I. Kennzeichnung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittelgesetzes aus Gummi, Kunststoffen und anderen Polymeren sowie aus Papier, Karton und Pappe.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Bedarfsgegenstände aus Papier und Pappe.- A. Wirtschaftliche Bedeutung.- B. Übersicht über Sorten und Anwendungen.- I. Amtliche Papierstatistik.- II. Gliederung nach dem Verwendungszweck.- III. Die als Bedarfsgegenstände im Sinne des Lebensmittelgesetzes infrage kommenden Sortengruppen.- 1. ZP-AP-Papiere.- 2. Gestrichene Papiere.- 3. Karton und Pappe.- 4. Fettdichte Papiere.- 5. Hygienische Papiere.- 6. Filterpapiere und Filtermassen.- 7. Zigarettenpapier.- 8. Kunststoffbeschichtete Papiere.- C. Lebensmittelrechtliche Situation von Papier, Karton und Pappe.- I. Beurteilung vom stofflichen Aufbau her.- 1. Papierrohstoffe.- 2. Fabrikationshilfsstoffe.- 3. Spezielle Papierveredelungsstoffe.- 4. Ergänzung der Empfehlung.- D. Untersuchungsmethoden.- I. Allgemeine Papierprüfung.- II. Chemische Analytik.- 1. Untersuchung an unbeschichteten Papieren.- III. Spezielle Prüfmethoden.- 1. Fettdichte.- 2. Wasserdampfdurchlässigkeit (WDDu).- 3. Gasdurchlässigkeit.- 4. Lichtdurchlässigkeit.- 5. Druckfarbenbeständigkeit.- 6. Geruchliche und geschmackliche Beeinflussung.- 7. Spezielle Prüfung von Filterpapieren.- 8. Ausblutechtheit von Farbstoffen und optischen Aufhellern.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Lacke, Lackfarben, Anstrichstoffe, andere Beschichtungsmittel, sonstige Farben soweit nicht zu Lebensmitteln gehörig.- A. Lacke, Lackfarben, Anstrichstoffe, andere Beschichtungsmittel und ihre Rohstoffe.- I. Einleitung: Wirtschaftliche Bedeutung, Zusammensetzung, Begriffe; Zweck und Aufgabe; Verwendung auf dem Lebensmittelgebiet.- 1. Wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklungstendenzen.- 2. Zusammensetzung und Nomenklatur für Lacke, Lackfarben, ihre Rohstoffe und verwandte Produkte.- 3. Zweck und Aufgabe von Lackierungen und Beschichtungen.- 4. Verwendung auf dem Lebensmittelgebiet.- II. Lackrohstoffe: Chemische Zusammensetzung, Eigenschaften, Anwendung und Bedeutung, gesundheitliche Beurteilung, analytische Methoden.- 1. Allgemeines und grundsätzliche analytische Methoden.- 2 Filmbildner und daraus hergestellte Lacke, Anstrichmittel und verwandte Produkte.- 3. Weichmacher.- 4. Lösungsmittel.- 5. Farbmittel und Füllstoffe (Verschnittmittel).- 6. Zusatzstoffe (Zusatzmittel, „Hilfsstoffe“; vgl. auch I. 4b).- 7. Zusammenfassung.- III. Die einzelnen Lackklassen.- 1. Einteilung.- 2. Eigenschaften und Verwendung.- 3. Anstrichaufbau.- 4. Zusammensetzung.- 5. Herstellung von Lacken und anderen Anstrichstoffen.- 6. Verarbeitung (Aufbringen bzw. Auftragen).- 7. Analyse von Lacken und anderen Beschichtungs- bzw. Anstrichstoffen.- 8. Analyse von Lackfilmen und Beschichtungs- bzw. Anstrichsystemen.- 9. Technologische, physikalische und chemische Prüfungen von Lacken und anderen Beschichtungsmitteln.- 10. Physiologisches Verhalten.- IV. Löslichkeit von Bindemitteln und Filmbildung von Lacken und anderen Beschichtungs- bzw. Anstrichmitteln.- 1. Löslichkeit von Bindemitteln in Lösungsmitteln.- 2. Filmbildung.- B. Graphische Farben (Druckfarben).- 1. Zweck und Druckverfahren.- 2. Zusammensetzung.- 3. Wichtige Eigenschaften.- 4. Physiologisches Verhalten.- 5. Analytische Hinweise.- C. Künstler- und Malfarben.- 1. Allgemeines.- 2. Ölfarben.- 3. Malmittel.- 4. Temperafarben.- 5. Aquarellfarben, Wasserfarben.- 6. Wasserdeckfarben.- 7. Plakatfarben, Plakattemperafarben.- 8. Pastellfarben.- 9. Künstlerfixative.- 10. Wandmalfarben (auf Putzen, Beton und anderen anorganischen Untergründen).- 11. Analytische Hinweise.- 12. Physiologische Hinweise.- D. Schreib- und Zeichenmaterialien.- 1. Bleistifte, Farb-, Kopier-, Farbkopierstifte (Tintenstifte).- 2. Fett- und Wachsstifte, Kreiden.- 3. Kugelschreiber-Tintenpasten.- 4. Tinten, Stempelfarben, Schreibbandfarben.- 5. Tuschen.- 6. Analytische Hinweise.- 7. Physiologische Hinweise.- Bibliographie.- Zeischriftenliteratur.- Bedarfsgegenstände aus Holz.- I. Einleitung.- II. Erzeugnisse aus Holz und Holzwerkstoffen, ihre Verwendung und wirtschaftliche Bedeutung.- 1. Lebensmittelherstellung, -lagerung und -verpackung.- 2. Lebensmitteltransport.- 3 Haushaltungen, Massenartikel.- 4. Wirtschaftliche Bedeutung.- III. Eigenschaften der verwendeten Hölzer, Holzwerkstoffe und Hilfsstoffe und ihr Verhalten gegenüber Lebensmitteln.- 1. Membransubstanzen.- 2. Akzessorische Bestandteile.- a) Nadelhölzer.- b) Laubhölzer.- 3. Holzwerkstoffe und Hilfsstoffe.- IV. Chemische Untersuchung von Holz, Holzwerkstoffen und Hilfsstoffen.- 1. Wasser.- 2 Akzessorische Bestandteile.- 3. Membransubstanzen.- 4 Hilfsstoffe.- V. Beurteilung.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Textile Bedarfsgegenstände, Pelze und Leder.- A. Fasern.- I. Wesensmerkmale der Fasern.- II. Welterzeugung an Textilfasern.- III. Nomenklatur.- IV. Chemischer, physikalischer und morphologischer Bau der Faser.- 1. Native Cellulose-Fasern.- 2. Eiweißfasern (Protein-Fasern).- V. Systematik der gewachsenen Fasern.- 1. Cellulosefasern.- 2. Eiweißfasern.- VI. Rohstoffe für Regenerat-Fasern.- 1. Cellulose.- 2. Alginsäure.- 3. Eiweiß.- VII. Synthetische Fasern.- 1. Polymerisationsprodukte.- 2. Kondensationsprodukte.- VIII. Umwandlung der polymeren Rohstoffe in Fasern.- IX. Oberflächenstruktur der Chemiefasern.- X. Bekleidungsphysiologie.- 1. Hygiene-Probleme.- 2. Toxikologie der Faserstoffe.- XI. Brennbarkeit der Textilien.- XII. Mineralische Faserstoffe.- 1. Asbest (gr. ä?????o? = unverbrennlich).- 2. Glasfasern.- Fachliteratur.- B. Pelze und Leder.- I. Rohstoffe.- II. Aufgaben der Pelz- und Lederbekleidung.- III. Wesen der Gerbung.- IV. Arbeitsmethoden.- 1. Veredelung von Pelzwerk.- 2. Gerberei.- 3. Imprägnierung.- 4. Lederfettung.- 5. Färberei des Leders.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Kosmetische Erzeugnisse.- I. Allgemeines.- 1. Definition der Kosmetik.- 2. Wirtschaftliche Bedeutung der Kosmetik.- 3. Gesetzgebung.- a) Körperpflegemittel allgemein.- b) Farbstoffe.- c) Quecksilberpräzipitat.- d) Zinkstearat.- e) Thioglykolsäure.- f) Hormone.- g) Methylalkohol.- h) Isopropylalkohol.- i) Giftverordnungen.- k) Verbotsliste.- 4. Analyse und Beurteilung kosmetischer Erzeugnisse.- II. Erzeugnisse zum Schutz und zur Pflege von Gesicht, Hand und Körper.- 1. Reinigungscremes.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Schmelzcremes.- c) Bienenwachs-Borax-Emulsionen (Coldcremes).- d) O/W- bzw. W/O-Emulsionen.- 2. Stearatcremes (Tagescremes und Grundlagencremes.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- 3. Gesichtspflegecremes.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- 4. Gesichtspflegemilche.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- 5. Gesichtswässer.- 6. Gesichtsmasken.- 7. Lichtschutzmittel.- a) Funktion der Lichtschutzmittel.- b) Bewertung der Lichtschutzsubstanzen.- c) Lichtschutzsubstanzen.- d) Zu fordernde Eigenschaften.- e) Erzeugnisformen.- 8. Rasierhilfsmittel.- a) Rasierseifen und Rasiercremes.- b) Rasierwässer.- c) Weitere Rasierhilfsmittel.- 9. Handpflegemittel.- a) Funktionen und Eigenschaften.- 10. Desodorierende und schweißhemmende Erzeugnisse.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Schweißhemmende Erzeugnisse (Antiperspirants).- c) Desodorierend wirkende Substanzen.- d) Erzeugnisformen.- 11. Badepräparate.- ?) Badesalze.- ?) Badeöle.- ?) Schaumbäder.- 12. Körperpuder.- III. Dekorative Kosmetik.- 1. Lippenstifte.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- 2. Make up-Präparate (Pudercremes, Tönungscremes).- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- 3. Rouge (Wangenrot).- 4. Gesichtspuder.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Anforderungen.- c) Zusammensetzung.- 5. Augen-Make up.- a) Augenschatten.- b) Wimperntusche (Mascara).- c) Augenbrauenstifte.- 6. Nagellack.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- 7. Nagellackentferner.- 8. Nagelhautentferner.- IV. Haarkosmetik.- 1. Haarwässer.- ?) Fettende Mittel.- ?) Bactericid wirkende Verbindungen.- ?) Hyperämisierend wirkende Mittel.- ?) Weitere Inhaltsstoffe.- 2. Haarpflegemittel (Frisierhilfsmittel).- a) Haaröle, Pomaden, Brillantinen.- b) Schleimdrogenpräparate (Frisiergelees, Wasserwellenfixative).- c) Haarcremes.- d) Haarlacke („Haarverfestigungsmittel“).- 3. Dauerwellmittel.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Heißwelle.- c) Kaltwelle.- c) Oxydation.- 4. Depiliermittel.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Depilierend wirkende Substanzen.- c) Weitere Inhaltsstoffe.- 5. Haarfarben.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Pflanzenfarben.- c) Metallsalze als Färbemittel.- d) Synthetische Farben.- 6. Haarbleichmittel.- 7. Haarwaschmittel (Shampoos).- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Erzeugnisformen.- c) Waschaktive Verbindungen.- d) Zusatzstoffe.- V. Mund- und Zahnpflege.- 1. Mundwässer.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Inhaltsstoffe.- 2. Zahnpflegemittel.- a) Funktionen und Eigenschaften.- b) Zusammensetzung.- VI. Verschiedenes.- 1. Parfümierung.- 2. Färbemittel.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Aerosole.- I. Begriffsbestimmung.- II. Aerosolprinzip.- III. Geschichte.- IV. Aerosolverpackungsmaterial.- 1. Behälter.- 2. Absperr- und Entnahmeventile.- 3. Schutzkappen.- V. Aerosol-Füll-Methoden.- VI. Aerosol-Treibgase und Treibgasverschnittmittel.- VII. Lösungsmittel für kosmetische Aerosole.- VIII. Aerosol-Gruppeneinteilung.- IX. Prüfteste für Aerosole.- 1. Applikationstest.- 2. Sprüh-Charakteristik-Test.- 3. Füll-Test.- 4. Beständigkeits-Test.- 5. Korrosions- und Hydrolyse-Test.- 6. Reiztest.- 7. Physiologische Teste.- 8. Brennbarkeitstest.- X. Aerosol-Analysen-Methoden.- 1. Fraktionierte Destillation.- 2. Gaschromatographie.- XI. Parfümierung von Aerosolen.- XII. Lebensmittel-Aerosole.- XIII. Pharmazeutische Aerosole.- XIV. Aerosol-Produktion und wirtschaftliche Bedeutung.- XV. Aerosol-Vorschriften.- XVI. Kosmetische Aerosol-Präparate.- Bibliographie.- Zeitschritenliteratur.- Patente.- Wachse, Paraffine, Kerzen.- A. Wirtschaftliche Bedeutung.- I. Welterzeugung.- II. Verbrauch in der Bundesrepublik.- B. Grundstoffe.- I. Wachse.- 1. Allgemeines.- 2. Esterwachse.- 3. Kohlenwasserstoffwachse.- II. Paraffine und Mikrowachse.- 1. Definition.- 2. Struktur. Chemismus und Kristallisation.- 3. Paraffinherstellung.- 4. Raffination.- 5. Unterschied zwischen Paraffin und Mikrowachs.- C. Verwendung der Paraffine und Wachse.- I. Paraffine in der Verpackungsindustrie.- II. Paraffine in der Kerzenindustrie.- 1. Gießverfahren.- 2. Zugverfahren.- 3. Tauchverfahren.- 4. Strangpreßverfahren.- III. Wachshaltige Pflegemittel.- 1. Allgemeines.- 2. Lösungsmittel.- 3. Sonstige Zusatzstoffe für wachshaltige Pflegemittel.- 4. Fußbodenpflegemittel.- 5. Möbelpflegemittel.- 6. Autopflegemittel.- 7. Wachsfluate.- 8. Schuhpflegemittel.- IV. Weitere Anwendungsgebiete.- 1. Käsewachs.- 2. Kaugummi.- 3. Auskleidung von Behältern.- 4. Dentalwachse.- 5. Einmachwachs.- 6. Geflügelrupfwachs.- 7. Modellier- und Attrappenwachs.- 8. Dauerwurst-Tauchwachs.- 9. Imprägnierwachs für Holzkisten zur Lebensmittelverpackung (Gemüse, Fisch).- 10. Wachs für Flaschenkorkbehandlung.- 11. Melkfett.- 12. Paraffindispersionen in der Papierindustrie.- 13. Fruchtbeschichtung.- 14. Blei-, Fett- und Buntstifte.- D. Untersuchungsmethoden.- I. Die Wachse.- 1. Allgemeines.- 2. Chemische Charakterisierung.- 3. Bestimmung physikalischer Eigenschaften.- 4. Untersuchung wachshaltiger Pflegemittel.- 5. Beurteilung.- II. Analysenmethoden für Paraffine und Mikrowachs.- 1. Physikalische Eigenschaften.- 2. Funktionelle Eigenschaften.- 3. Arbeitsweise zur Konstitutionsermittlung.- E. Behandlungsvorschrift für Fest- und Flüssigparaffin und für paraffiniertes Verpackungsmaterial.- F. Lagerung paraffinierter Papiere und Kartonabschnitte.- G. Wachse im Hinblick auf das Lebensmittelgesetz.- H. Reinheitsanforderungen an Paraffin und Mikrowachs in der Lebensmittelgesetzgebung.- 1. Allgemeines.- I. Spezielle Methoden zur Kontrolle vorgeschriebener Reinheitsanforderungen.- I. Prüfungen im Rahmen der XXV. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes BGA.- 1. Schwefelsäuretest.- 2. Prüfung der Farbe (Jodfarbzahl).- 3. Prüfung der Fluoreszenz.- 4. Prüfung auf polycyclische Aromaten.- II. Reinheitsprüfung nach Vorschrift der Federal Drug Administration (FDA).- III. Reinheitsprüfung für Paraffin nach DAB VII.- IV. Untersuchung beschichteter Verpackungsmaterialien.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Petroleum und Verkehr mit feuergefährlichen Stoffen.- A. Petroleum.- I. Allgemeines und Zusammensetzung.- II. Untersuchung und Beurteilung.- III. Andere Produkte mit Brennstoffeigenschaften.- B. Zündwaren.- I. Geschichtliche Entwicklung.- II. Allgemeines und Zusammensetzung.- III. Untersuchung und Beurteilung.- C. Feuerwerkskörper und Sprengstoffe.- I. Allgemeines und Zusammensetzung.- II. Untersuchung und Beurteilung.- D. Hinweise für die rechtliche Beurteilung.- I. Petroleum und andere brennbare Füssigkeiten.- II. Zündwaren.- III. Pyrotechnische Gegenstände und Sprengstoffe.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Lebensmittelbetrieb.- 1. Geschichtliche Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.- 2. Definition der wichtigsten Begriffe.- a) Reinigen.- b) Waschen.- c) Spülen.- d) Desinfektion.- e) Sterilisation.- f) Sanitation.- 3. Grundlagen der Reinigung und Desinfektion.- a) Grundlagen der Reinigung.- b) Grundlagen der Desinfektion.- 4. Aufbau, chemische Zusammensetzung und Eigenschaften der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.- a) Reinigungsmittel.- ?) Alkalische Reinigungsmittel.- ?) Neutrale Reinigungsmittel.- ?) Saure Reinigungsmittel.- ?) Beispiele für alkalische Reinigungsmittel.- ?) Beispiele für neutrale Reinigungsmittel.- ?) Beispiele für saure Reinigungsmittel.- b) Desinfektionsmittel.- c) Kombinierte Reinigungs- und Desinfektionsmittel.- 5. Praktische Durchführung von Reinigung und Desinfektion.- a) Manuelle und maschinelle Verfahren der Reinigung.- ?) Allgemeines.- ?) Handreinigung.- ?) Zirkulationsverfahren (cleaning in place: „CIP“).- ?) Reinigung von Plattenerhitzern.- ?) Automatische Tankreinigung.- ?) Reinigung von größeren Gefäßen, Kannen, Fässern, Premix-Behältern, Korbflaschen.- ?) Automatische Flaschenreinigung.- ?) Tauchreinigung und sonstige Reinigung von Spezialapparaten.- b) Praktische Durchführung der Desinfektion.- ?) Allgemeines.- ?) Chlorabspaltende Desinfektionsmittel in milchwirtschaftlichen Betrieben.- ?) Quaternäre Ammoniumbasen.- ?) Jodophore.- ?) Andere Desinfektionsmittel.- ?) Dosier- und Zumischgeräte für die Desinfektionslösungen.- ?) Andere Desinfektionsverfahren.- c) Voraussetzungen für die kombinierte Reinigung und Desinfektion.- 6. Untersuchungs- und Kontrollmethoden.- a) Allgemeines.- ?) Chemische Untersuchung der Reinigungs- und Desinfektionslösungen.- ?) Bakteriologische Untersuchungsverfahren.- ?) Visuelle Kontrollen.- b) Konzentrationsbestimmungen in gebrauchsfertigen Lösungen.- c) Bestimmung der Wirksamkeit.- d) Korrosionsfragen.- 7. Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Kontakt mit Lebensmitteln.- 8. Anforderungen an die Beschaffenheit des Wassers für Reinigungs- und Desinfektionszwecke.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Patente.- Schädlingsbekämpfungsmittel.- I. Einführung.- 1. Schädlinge und ihre Bedeutung.- 2. Wege der Schädlingsbekämpfung.- Überblick über Schädlingsbekämpfungsmittel.- a) Abgrenzung.- b) Umfang des Einsatzes.- c) Praktische Anwendung.- II. Aufbau der Schädlingsbekämpfungsmittel.- 1. Wirkstoffe.- a) Insektenbekämpfungsmittel.- b) Acaricide.- c) Nematicide.- d) Rodenticide.- e) Molluscicide.- f) Fungicide.- g) Herbicide.- 2. Zusatzstoffe.- a) Synergisten.- b) Hilfsstoffe.- III. Toxicität.- 1. Allgemeines.- a) Akute Toxicität.- b) Chronische Toxicität.- 2. Spezielle Wirkungen einzelner Schädlingsbekämpfungsmittel.- a) Insecticide Chlorkohlenwasserstoffe.- b) Insecticide Phosphorsäure und Carbaminsäureester.- c) Übrige Schädlingsbekämpfungsmittel.- 3. Schutzmaßnahmen.- IV. Rückstandsbildung und Festlegung von Toleranzen.- 1. Allgemeine Begriffe und Grundlagen.- 2. Rückstände im Boden.- a) Bildung von Rückständen.- b) Beeinflussung der Rückstände.- c) Beeinflussung des Bodens.- d) Abbau der Rückstände.- 3. Rückstände auf und in Pflanzen.- a) Bildung von Rückständen.- b) Beeinflussung der Rückstände.- c) Beeinflussungen der Pflanzen.- d) Abbau der Rückstände.- 4. Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln bei Tier und Mensch.- a) Bildung von Rückständen.- b) Verhalten der Rückstände.- c) Abbau von Rückständen.- 5. Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln in Luft und Wasser.- a) Rückstände in Luft.- b) Rückstände in Wasser.- 6. Festlegung von Toleranzen.- V. Einfluß von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Lebensmittel.- 1. Einfluß auf die stoffliche Zusammensetzung von Lebensmitteln.- a) Insecticide.- b) Übrige Schädlingsbekämpfungsmittel.- 2. Einfluß auf senorisch wahrnehmbare Eigenschaften.- a) Äußere Beschaffenheit.- b) Geruch und Geschmack.- VI. Verhalten der Rückstände bei der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung.- 1. Waschen.- 2. Mechanische Bearbeitung.- 3. Thermische Behandlungsverfahren.- a) Kochen, Blanchieren und Sterilisieren.- b) Konzentrieren.- c) Sonstige Verfahren.- 4. Enzymatische Prozesse.- a) Beständigkeit.- b) Einfluß auf enzymatische Prozesse.- VII. Hinweise zur Rückstandsanalyse.- 1. Spezielle Verhältnisse in der Rückstandsanalystik.- a) Konzentrationsbereich.- b) Vortest.- c) Identifizierung der Wirkstoffe.- 2. Hinweise zur Entnahme und Lagerung von Analysenproben.- a) Probenahme.- b) Lagerung der Proben.- 3. Kriterien der Analysenverfahren.- a) Empfindlichkeit.- b) Nachweis- und Bestimmungsgrenze.- c) Rückgewinnungsquote.- d) Wiederholbarkeit (Reproduzierbarkeit).- 4. Toleranzwerte und Analytik.- a) Problematik der O-Toleranz.- b) Überschreitung der Toleranz.- Bibliographie.- Zeitschriftenliteratur.- Hinweise zur lebensmittelrechtlichen Beurteilung von Anstrichmitteln usw., Kunststoffen und anderen Polymeren.- 1. Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen.- 1a. Verordnung über die Zulassung fremder Stoffe als Zusatz zu Lebensmitteln.- 1b. Verordnung über färbende Stoffe (Farbstoff-Verordnung).- 1c. Verordnung über Kaffee.- 2. Gesetz, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen.- 3. Verordnung zum Schutze gegen Bleivergiftung bei Ansticharbeiten.- 4. Gesetz, betreffend den Verkehr mit Blei- und zinkhaltigen Gegenständen.- 5. Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch.- 6. Milchgesetz.- 7. Verordnung (EWG) Nr. 1619/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über Vermarktungsnormen für Eier.- 8. Das neue Gesetz über Wein, Dessertwein, Schaumwein, weinhaltige Getränke und Branntwein aus Wein (Weingesetz).- 9. Butterverordnung.- 10. Käseverordnung.- 11. Verordnung über Obsterzeugnisse.- 12. Verordnung über Speiseeis.- 13. Verordnung über Tafelwässer.- 14. Verordnung über Getränkeschankanlagen (Getränkeschankanlagenverordnung).- Sonstige Beurteilungsgrundlagen.
1997-2025 DolnySlask.com Agencja Internetowa
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa